In meinem letzten Beitrag hatte ich verschiedene Wertberechnungsmethoden für freiwillige (unbezahlte) Leistungen dargestellt. Von der Annahme ausgehend, dass sich für jedes freiwillige Engagement ein Adäquat auf dem (ersten) Arbeitsmarkt finden lässt, kann wahlweise der Out- oder der Input Engagierter berechnet und damit der Geldwert freiwilligen Engagements ermittelt werden. Ich hatte gezeigt, dass dabei auf der einen Seite mitnichten klar ist, was denn eigentlich unbezahlte Arbeit — als ein wesentlicher Aspekt freiwilligen Engagements — ist und andererseits auch die Out- oder Inputrechnung nicht auf wirklich belastbarem Boden steht. Im Grunde sprechen wir hier eher von wage angenommenen Mittelwerten, die sich ergeben müssten, damit diese Rechnung (annähernd) die Realität abbildet, als irgendwelchen „hart facts“ als die sie nur all zu oft verkauft werden.
Anschließend an meinen Beitrag kritisierte Gerald Czech an der Monetarisierung freiwilligen Engagements, dass die implizite Annahme der Äquivalenz freiwilliger und marktwirtschaftlich erbrachter Leistungen (Output) bzw. gestellter Personalressourcen (Input) alle anderen Dimensionen zivilgesellschaftlichen Engagements „ceteris paribus“ vernachlässigt. Das utilitaristische Paradigma marktwirtschaftlicher Argumentationslogik ist ihm zufolge nicht im Stande den wahren Wert freiwilligen Engagements abzubilden. Aus der Schwarz-Weiß-Perspektive des Auszahlens / nicht Auszahlens von Geldinvestitionen würde schlicht vergessen, das im freiwilligen Engagement der „Kitt der Gesellschaft“, das „essentielle soziale Kapital“ entsteht, dass die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft zusammenhält.
Es ist wohl wahr: in der Monetarisierungsdebatte rund um das freiwillige Engagement werden vermeintlich „weiche Faktoren“ nur all zu schnell vernachlässigt. Da sich aber zivilgesellschaftliche Organisationen — wie im letzten Beitrag erwähnt — schon seit geraumer Zeit auf einem Markt wirtschaftspolitisch begründeter Alimentationsoptionen bewegen, bleibt die Diskussion um sinnvolle Kennzahlsysteme für effizientes Freiwilligen- und Stakeholdermanagement dennoch wichtig. Freiwilligenarbeit — so heißt es immer wieder — ist weder kostenlos noch umsonst und so greift auch das Argument eines Preisbildungsparadox’ zu kurz.
Beim Preisbildungsparadox geht man allgemein davon aus, dass zur Bildung eines Preises für irgendein Produkt oder irgendeine Dienstleistung immer auch der Markt, also diejenigen, die den Preis bezahlen sollen, betrachtet werden muss. Da der Eigensinn freiwilligen Engagements aber nahe legt, dass hier eben hauptsächlich Leistungen erbracht werden, die ohnehin niemand bezahlen kann oder will, gibt es bei der Preisbildung für freiwilliges Engagement eigentlich kein Gegenüber, was freiwilliges Engagement positiv ausgedrückt unbezahlbar macht, in der marktwirtschaftlichen Argumentationslogik aber vollkommen entwertet.
Nicht betrachtet wird dabei, dass freiwilliges Engagement auch maßgeblich zu sozialer Befriedung im Gemeinwesen, zur Bildung sozialen Kapitals als individuelle wie gemeinschaftliche Ressource, zur Durchsetzung gesellschaftlich anerkannter (oder mithin auch anzuerkennender) Werte zu nachhaltiger Entwicklung und vielem mehr beiträgt. Freiwilliges Engagement als eine Möglichkeit sich als Citoyen aktiv in das Gemeinwesen und damit auch ein Stück weit in die Gesellschaft einzubringen, ist ein äußerst wertvolles Gut, dessen Beförderung vielerlei Akteuren auch einiges Wert ist.
Wie es kürzlich auch Rupert Graf Strachwitz im BBE-Newsletter pointiert festhielt, gehört unsere Bundesregierung momentan zwar nicht dazu, doch haben nebst zivilgesellschaftlichen Organisationen auch Versicherungen und Wohnungsbaugenossenschaften ehrliches (weil auch marktwirtschaftlich begründetes) Interesse an der Förderung freiwilligen Engagements. Interessiert sind diese Akteure weniger an irgendeiner marktadäquaten Leistung Freiwilliger als vielmehr an der nachhaltigen Entwicklung ihrer Aktionsgebiete — z.B. geringer Fluktuation der Mieterinnen und Mieter bzw. niedrige Kriminalität in einem bestimmten Stadtviertel. Eine Kennzahl in Gestalt der einfachen Kapitalrendite (RoI), also der Gegenüberstellung von Gesamtinvestition und (fiktiven) Geldrückflüssen, wäre hier eher nicht angebracht. Als Kennzahlsystem scheint die Sozialrendite, der Social Return on Investment hier wesentlich sinnvoller.
Social Return on Investment
Der Social Return on Investment (SRoI) wird seit den 1990er Jahren als Erweiterung der einfachen Kapitalrendite (RoI) auf die Abbildung sozialer Auswirkungen (social impacts) von Investitionen entwickelt. Der Roberts Enterprise Development Fund (REDF) wird immer wieder als maßgeblicher ‚Geburtshelfer’ dieses dynamischen Kennzahlsystems genannt. Als wichtige Wegbegleiterin ist jedoch auch die britische new economics foundation (nef) zu nennen (Reichelt 2009).
Für die SRoI-Rechnung lässt sich also ganz grundsätzlich festhalten, dass der Kapitalinvestition neben den ökonomischen auch die sozialen Werte gegenüber gestellt werden. Da es sich beim SRoI aber — wie beim RoI auch — um eine Renditerechnung handelt, kann nur das einbezogen werden, was sich auch in Zahlen (genauer gesagt: in Geldwerten) ausdrücken lässt. Da sich soziale Werte — wenn überhaupt — nur sehr schwer quantifizieren lassen, muss auf eine Brücke zwischen ökonomischen und sozialen Werten abgestellt werden — den sozioökonomischen Werten.

Beispielhaft wird für die SRoI-Rechnung immer wieder die Beratung und Qualifizierung langzeitarbeitsloser Menschen genannt: Durch die Qualifizierung Arbeitsloser zur Selbstständigkeit spart der Staat auf lange Sicht nicht nur die Ausgaben für den Regelsatz des Arbeitslosen sondern kann auch darauf hoffen in Zukunft mehr Geld durch dessen Lohnsteuern einzunehmen. Die Verbesserung der sozioökonomischen Verhältnisse einstmaliger Klientinnen und Klienten, die in direkten Zusammenhang mit der Projekt- bzw. Programminvestitionen gebracht und in Geldwerten ausgedrückt werden können, fließen in die SRoI Rechnung mit ein. Nicht monetarsierbare Effekte, wie vielleicht die psychische (De-)Stabilisierung durch selbstständige Arbeit, dagegen können nicht mit einfließen, da sie nicht sicher in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werde n können.
n können.
Fazit
Grundsätzlich unterscheidet sich der SRoI also nur wenig von der Monetarisierung freiwilligen Engagements, wie sie bereits in mehreren Studien unternommen wurde — mit entsprechenden Folgen: Da zu den fiktiven Geldrückflüssen, den eingesparten bzw. kompensierten Kosten lediglich erwartbare Geldrückflüsse hinzugerechnet werden, die direkt mit der Investition in Zusammenhang zu bringen sind, schneiden die Investitionsoptionen gut ab, die finanzielle Entlastungen erwartbar machen. Denjenigen Organisationen aber, die bspw. Arbeitslose bei der Beantragung von Geldmitteln unterstützen, müsste ein negativer SRoI bescheinigt werden, weil der Outcome ihrer Arbeit eben nicht die Entlastung des Fiskus ist oder zukünftige Mehreinnahmen erwartbar macht.
Utilitaristisch gesprochen hieße das also, dass der Staat — wie auch Spendende Steuerzahlerinnnen und Steuerzahler — gut daran täten, Projekte und Programme mit einer negativen Sozialrendite nicht zu unterstützen. Dass das allerdings viele Sozialarbeiter(innen) in Deutschland arbeitslos machen würde, die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander treiben und langfristig zu untragbaren sozialen Spannungen führen könnte, kann in der Renditerechnung nicht berücksichtigt werden — es wären ebne nicht intendierte Folgen zielgerichteten Handelns, Kollateralschäden einer BWLisierte Gesellschaft.
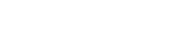
[…] (Zur von Thorsten Jahnke angesprochenen Kritik und im Bezug auf freiwilliges Engagement siehe hier und hier) […]