 Facebook ist unschlagbar, wenn es um die Ansprache junger Zielgruppen geht. 97,3% der jungen Menschen (14 bis 29 Jahre) sind schließlich online ([N]Onliner-Atlas 2011) und 71% davon nutzen täglich (63%) oder mindestens wöchentlich (30%) soziale Netzwerke (ARD/ZDF Onlinestudie). Grund genug also sich ein Account bei Facebook anzulegen und nun endlich auch den Nachwuchs zu erreichen. Der schaut schließlich schon lange nicht mehr einfach so in der Einrichtung vorbei. Der will ansprechend umworben und geködert werden und zwar in seinem eigenen, seinem digitalen Ökosystem – dem Social Web.
Facebook ist unschlagbar, wenn es um die Ansprache junger Zielgruppen geht. 97,3% der jungen Menschen (14 bis 29 Jahre) sind schließlich online ([N]Onliner-Atlas 2011) und 71% davon nutzen täglich (63%) oder mindestens wöchentlich (30%) soziale Netzwerke (ARD/ZDF Onlinestudie). Grund genug also sich ein Account bei Facebook anzulegen und nun endlich auch den Nachwuchs zu erreichen. Der schaut schließlich schon lange nicht mehr einfach so in der Einrichtung vorbei. Der will ansprechend umworben und geködert werden und zwar in seinem eigenen, seinem digitalen Ökosystem – dem Social Web.
Auch ich habe nicht nur einmal darauf hingewiesen, dass soziale Organisationen dort kommunizieren sollten, wo ihre (zukünftigen) Stakeholder sind. Das Internet — und insbesondere soziale Netzwerke — eigenen sich hervorragend dafür, mit „seinen Leuten“ in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Doch einfach einen Account bei Facebook anzulegen reicht dafür offenbar nicht aus. Vor allem die Facebook-Profile (häufig sind es noch nicht einmal Seiten) kleinerer Organisationen verwaisen schnell. Das mag zum einen daran liegen, dass die Pflege dieser Social Web Auftritte — wenn überhaupt Geld im Spiel ist — grandios unterfinanziert sind bzw. die eingestellten Updates nicht den Modi moderner Kurz-Kurz-Kommunikation entsprechen, könnte aber auch mit einer weitgehend untauglichen Vorstellung von Sozialraum korrespondieren.
Modelle der Sozialraumaneignung
Verena Ketter diskutierte in der Juni-Ausgabe der merz (Zeitschrift für Medien und Erziehung), die sich ganz speziell dem Thema „Jugendarbeit und social networks“ widmet, eben diese Sozialraummodelle. In Anschluss an Martina Löw stellt sie dabei fest, dass die Sozialraumaneignung als bedeutende Leistung während der Sozialisation junger Menschen heute anders vonstattengeht als früher.
Infolge medientechnologischer Entwicklungen (Computer, Internet und Handy) erleben Heranwachsende heutzutage Raum als fragmentär, gestaltbar, bewegt und punktuell verknüpft wie ein ‚fließendes Netzwerk‘ (Löw 2001, S. 266). Jugendliche eigenen sich, neueren Raumtheorien entsprechend, den Sozialraum nicht mehr in einer sukzessiven Erweiterung des Handlungsraumes in konzentrischen Kreisen an wie beispielsweise bei dem sozialökologischen Zonenmodell (Baake 1987). Vielmehr wird Raum im Sinne einer Fortschreibung des Inselmodells nach Helga Zeiher (1983), das auch die Entstehung mehrerer Räume an einem Ort zulässt, erfahren (Ketter 2011: 20).
 Ketter zu folge ist für die heutige Sozialisation also nicht anzunehmen, dass Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungswelt ausgehend von deren Zentrum (der Familie [i.w.S.] als erste Sozialisationsinstanz) um die der Nachbarschaft, den des Wohnortes und schließlich den der weitgehend unbekannten Außenwelt sukzessive erweitern. Vielmehr konstruieren sie (mehr oder weniger eigenständig) Erfahrungsräume, die sich nicht mehr in geographisch-territorial zusammenhängenden Kategorien beschreiben lassen. Bildlich lässt sich hier also von „Inseln“ sprechen, die nicht unbedingt miteinander verbunden sein müssen. Schon in früheren Zeiten, als Helga Zeiher ihr Inselmodell formulierte, musste der Judo-Verein eines Jugendlichen nichts mit dessen Schulklasse oder der direkten Nachbarschaft seiner Familie zu tun haben. Ebenso wenig, wie es heute Verbindungen zwischen dem freiwilligen Engagement bspw. beim Rettungsdienst und dem Freundes- und Bekanntenkreis auf Facebook geben muss; was vor allem dann anzunehmen ist, wenn keine Verknüpfungsmöglichkeiten beider Erfahrungsräume bestehen.
Ketter zu folge ist für die heutige Sozialisation also nicht anzunehmen, dass Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungswelt ausgehend von deren Zentrum (der Familie [i.w.S.] als erste Sozialisationsinstanz) um die der Nachbarschaft, den des Wohnortes und schließlich den der weitgehend unbekannten Außenwelt sukzessive erweitern. Vielmehr konstruieren sie (mehr oder weniger eigenständig) Erfahrungsräume, die sich nicht mehr in geographisch-territorial zusammenhängenden Kategorien beschreiben lassen. Bildlich lässt sich hier also von „Inseln“ sprechen, die nicht unbedingt miteinander verbunden sein müssen. Schon in früheren Zeiten, als Helga Zeiher ihr Inselmodell formulierte, musste der Judo-Verein eines Jugendlichen nichts mit dessen Schulklasse oder der direkten Nachbarschaft seiner Familie zu tun haben. Ebenso wenig, wie es heute Verbindungen zwischen dem freiwilligen Engagement bspw. beim Rettungsdienst und dem Freundes- und Bekanntenkreis auf Facebook geben muss; was vor allem dann anzunehmen ist, wenn keine Verknüpfungsmöglichkeiten beider Erfahrungsräume bestehen.
Bei der Netzkommunikation „dort wo die (zukünftigen) Stakeholder sind“ muss es folglich darum gehen, eben diese Verknüpfungsmöglichkeiten anzubieten. So könnten schließlich zumindest lose Kopplungen möglich gemacht werden. Denn nur weil die eine Insel nichts mit der anderen zu tun haben muss, heißt das ja nicht, dass beide Erfahrungsräume nichts miteinander zu tun haben können. Der Erfolg oder Misserfolg von Social Web Auftritten liegt dementsprechend — und auch hier schreibe ich auch nichts Neues — in der Aktivität der Follower und Fans, die diese Brücken zwischen den immer eigenen Erfahrungsräumen schlagen. Eben hier scheinen aber viele Akteurinnen und Akteure im Social Web zu scheitern, weil sie weniger die Aktivität ihrer Stakeholder fördern — meint: die Qualität der Beziehungen ausbauen — als vielmehr auf eine quantitative Ausweitung potentieller Kontakte zu fokussieren (mehr Fans auf Facebook, mehr Follower auf Twitter usw.).
Öffentlichkeitsarbeit im Social Web
Sicherlich sind viele Kontakte von Vorteil. Auf Facebook-Seiten, die von vielen hunderten, vielen tausenden Fans verfolgt werden, ist schließlich auch einiges an Aktivität zu beobachten. Doch kann diese eben nur dann mit der Ansprache neuer Zielgruppen einhergehen, wenn die Aktiven dazu ermutigt werden, Brücken in eigene Erfahrungsräume zu schlagen — wenn sie einen Grund sehen (bzw. sich einen Vorteil davon versprechen) den Content weiter zu verbreiten und ggf. eigene Geschichten drum herum zu spinnen. Gelingt dies nicht, schmort die Gemeinschaft im eigenen Saft und aller (professionellen und z.T. gut bezahlten) Social Media Aktivitäten zum Trotz wird der Nachwuchs kaum angesprochen.
Wer sich die so auffällige Aktivität auf größeren Facebook-Seiten etwas genauer ansieht, wird feststellen, dass diese zumeist von jenen ausgeht, die ohnehin mit der jeweiligen Organisation assoziiert sind — in deren Profilen sich nicht selten die jeweilige Organisation als „Arbeitgeber“ findet. Zwar wird deren „Like“ (auf) einer Facebook-Seite auch in ihrem Profil angezeigt, der Content somit verbreitet, doch fehlt die Geschichte drum herum. Wie ein Retweet auf Twitter muss ein Like auf Facebook zunächst als neutrale Weiterverbreitung angesehen werden. Erst das Teilen von Inhalten und ganz speziell das Teilen mitsamt einem eigenen Kommentar hat das Potential einer persönlichen Empfehlung – nämlich hohe, sehr hohe ja die höchste Glaubwürdigkeit im eigenen Netzwerk.
Damit ist (erneut in diesem Blog) ein Themenbereich angesprochen, mit dem sich viele (traditionelle) Organisationen des Dritten Sektors noch schwer tun: Der strategische Einbezug privater Web-Kommunikation in die organiationale Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Vorstellung im Kopf, die Öffentlichkeitsarbeit wäre exklusives Tätigkeitsfeld der entsprechenden Abteilung und die Kameradinnen und Kameraden der PR wären auch wegen ihrer Ausbildung und der damit einhergehenden Entlohnung für die Lösung derartige Probleme zuständig, wird der dysfunktionale Status Quo — alle Öffentlichkeitsarbeit geht von der PR-Abteilung aus — nicht selten auch von den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden verteidigt, die sich außerhalb der Öffentlichkeitsarbeit wähnen. Übersehen wird dabei, dass die Werbung von Nachwuchs für gemeinnützige Organisationen schon immer ganz maßgeblich über private Netzwerke — den „word of mouth“ — lief.
Die Auswirkungen dieser „Mund-zu-Mund-Propaganda“ haben sich mit den neuen Technologien — und vor allem mit dem Internet — aber stark verändert, was eben nahe legt, dass sich auch die Öffentlichkeitsarbeit verändern muss. Es kann schon lange nicht mehr darum gehen, der PR aufzutragen, die Organisation gut aussehen zu lassen. Wer heute den Nachwuchs in seinem digitalen Ökosystem erreichen will, muss auf Empowerment statt Vorschriften, Eigeninitiative statt Fremdbestimmung und neue Wegen statt ausgetretener Pfade setzen. In diesem Sinne bleibt die Öffentlichkeitsarbeit nicht länger allein von den Kolleginnen und Kollegen der PR vorbehalten, sondern geht mehr und mehr von den Aktiven aus. Denn nur sie können ihre eigenen Netzwerke mit jeweils relevanten Informationen versorgen.
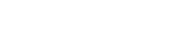
Lesenswerter Blog-Post: RT @foulder: Sozialraum Facebook — dort sein wo die Zielgruppe ist?! http://t.co/wbFV4Lv
Vielen Dank! RT @KatrinKiefer: Lesenswerter Blog-Post: Sozialraum Facebook — dort sein wo die Zielgruppe ist?! http://t.co/VP6gzML
Lesenswerter Blog-Post: RT @foulder: Sozialraum Facebook — dort sein wo die Zielgruppe ist?! http://t.co/wbFV4Lv
Vielen Dank! RT @KatrinKiefer: Lesenswerter Blog-Post: Sozialraum Facebook — dort sein wo die Zielgruppe ist?! http://t.co/VP6gzML
[…] zwischen 13 und 20 Jahren. Damit reagierte die TU Dortmund und das DJI auf die sich abzeichnenden Veränderungen jugendlicher Lebens- und Erlebenswelten, die heute häufiges Thema in medienpädagogischen Debatten sind. Der wohl auch heute noch […]
[…] “Sozialraum Facebook” resp. die Lebensrealität junger Menschen erweitern. Ich hatte schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass veraltete Vorstellungen sozialen Raums in Zeiten des “Web 2.0″ […]
[…] dieses Engagement strukturell verankern und somit verstetigen zu können. Der Einsicht, man müsse dort sein wo die Zielgruppe ist, folgt selten das Gespür für die tatsächlichen Relevanz der […]
[…] (informelles) Engagement Jugendlicher, über ihre Mediennutzung und Vergemeinschaftung im “Sozialraum Facebook“. “Mediatisierung” wird hier die mediale Durchdringung aller […]
[…] wenig Phantasie, das von Schulze auf physisches Zusammentreffen gemünzte lokale Publikum auf den Sozialraum des Web 2.0 zu […]