 Über den aktuellen Stern-Titel hatte ich bereits kurz bei Google+ geschrieben. Der Pop-Philosoph Richard David Precht erklärt dort im Interview, “was im Leben zählt” und zeigt sich damit voll im Trend. Precht wird von Andrea Ritter textlich als Außenseiter seiner Zunft beschrieben. Dafür zitiert sie zunächst Schmähungen wie “Philosoph der Bahnhofsbuchhandlung” oder “Schlaumeier, der zu allem eine Meinung hat”, um anschließend Richard David Precht seine Personenmarke selbst beschreiben zu lassen:
Über den aktuellen Stern-Titel hatte ich bereits kurz bei Google+ geschrieben. Der Pop-Philosoph Richard David Precht erklärt dort im Interview, “was im Leben zählt” und zeigt sich damit voll im Trend. Precht wird von Andrea Ritter textlich als Außenseiter seiner Zunft beschrieben. Dafür zitiert sie zunächst Schmähungen wie “Philosoph der Bahnhofsbuchhandlung” oder “Schlaumeier, der zu allem eine Meinung hat”, um anschließend Richard David Precht seine Personenmarke selbst beschreiben zu lassen:
Ich habe eine gesellschaftliche Rolle eingenommen, die in Deutschland unbesetzt war. […] Die Rolle des öffentlich präsenten Intellektuellen.
Es war der Sozialphilosoph Jürgen Habermas, der 2006 in einem Vortrag anlässlich der Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch 2005 das Fehlen dieser öffentlich präsenten Intellektuellen beklagte, die es es Ländern wie Frankreich tatsächlich in größerer Zahl gibt. Vorteilhaft an diesen Personen öffentlichen Lebens, so Habermas, sei vor allem die intellektuelle Orientierung, die sie bieten könnten. Ein Feld, dass in Deutschland nun der Herr Precht gern besetzten will. Und das nicht, wie ‘all die anderen’ “griesgrämigen Bedenkenträger, die in Talkshows, Interviews oder Essays befinden, dass die Welt den Bach runter geht und früher alles besser war”. Viel lieber möchte Precht nach vorn schauen, für die abendländische Philosophie begeistern und für den “Gedanken der Aufklärung” anstatt den “esoterischer Sinnsuche” werben.
Angesichts der Tatsache, dass wir mittlerweile von der zweiten oder ‘anderen’ bzw. Postmoderne zu sprechen pflegen und das Zeitalter der Aufklärung auf das 17. und 18. Jahrhundert datieren, frage ich mich, was am Werben für den “Gedanken der Aufklärung” vorwärtsgewandt sein soll. Ging es dem Vorzeigeaufklärer Immanuel Kant noch darum, die Menschen aus ihrer “selbstverschuldeten Unmündigkeit” zu befreien, muss es doch heute eher darum gehen, sie für den Umgang mit ihrer “unschuldigen Mündigkeit” (Ronald Hitzler) fit zu machen. Einen Hinweis darauf, was mit dem “Gedanken der Aufklärung” hier gemeint sein könnte, liefert die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Hier wird in der die Bedeutung des jeweils zu erläuternden Lemmas schon in den ersten Zeilen vom alltäglichen Sprachgebrauch abgegrenzt. So heißt es zum Lemma “Aufklärung”:
Aufklärung steht im alltäglichen Sprachgebrauch für das Bestreben, durch den Erwerb neuen Wissens Unklarheiten zu beseitigen, Fragen zu beantworten, Irrtümer zu beheben …
Und genau das scheint das Kern der Personenmarke Richard David Precht zu sein: Licht ins Dunkel bringen, Fragen beantworten (oder erst einmal wichtige Fragen stellen), Irrtümer aus der Welt schaffen; und das möglichst mit Breitenwirkung. Heikel nur die Frage, woher die Gewissheiten, die hier referiert werden, stammen. Spannend die Frage, aus welcher Perspektive Precht auf die Welt blickt. Kritisch die Frage, ob’s doch nichts anderes ist als Opium für’s Volk.
Was im Leben zählt
Meine These für die folgende Betrachtung Prechts Meinungen zur Frage, “was im Leben zählt”, ist folgende: Die Resultate seiner Überlegungen entstammen einem heute weit verbreiteten Verständnis von sozialer Welt und sind damit ganz wunderbar an das breite Publikum anschlussfähig. Prechts Thesen entsprechen recht häufig dem, was wir hören wollen bzw. was in unser Weltbild passt. Er referiert, was wir uns selber denken könnten und nimmt uns damit aus der Pflicht, es selber sagen oder schreiben zu müssen. Dabei ist er selten so provokativ, dass er mit ernstlichem Widerspruch rechnen müsste, zumal er als aufklärender Denker ja ohnehin keine Verantwortung für die Folgen seiner Ratschläge übernehmen müsste.
Einen ersten wesentlichen Punkt in Prechts Ausführungen sehe ich in seiner These der “Befindlichkeitsdemokratie“. Da wir heute “so wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten haben”, meint Precht, wüssten wir nicht mehr, was wir denken und wie wir uns entscheiden sollen. Deshalb würden wir häufig dem Bauchgefühl folgen und damit eben auch zweifelhafte Entscheidungen treffen. Ein Problem, dass noch durch den Umstand verschärft wird, dass jede Wahl auch eine Abwahl und damit ein Risiko darstellt (Ulrich Beck). Deshalb, meint Precht, bräuchten wir verlässliche Mittel zur rationalen Abwägung wie den Utilitarismus. Jeremy Benthams größtes Glück für die größte Zahl ist dabei mitnichten neu. Mit seiner praktischen Anwendbarkeit und sicherlich auch wegen seiner Schlichtheit ist der Utilitarismus wohl eines der am weitesten verbreiteten Denkmodelle der Moderne. Vor allem in den Gesellschaftsbereichen, aus denen über Jahrzehnte kaum Widerstand dagegen zu befürchten war, ist er am weitesten verbreitet. Das deutsche Sozialgesetzbuch strotzt nur so davon.
Folgen wir also Precht in dieser wahrlich bürgerlich-populistischen Ansicht, dass ethisch Gut ist, was das größte Glück für die größte Zahl bedeutet, zeigt sich, dass er, wenn er über “Bürgergesellschaft” spricht — und das tut er im Interview –, eher der philosophischen Strömung des Kommunitarismus, denn dem des Liberalismus folgt (zu den Begriffen siehe bspw. Jähnert/Breidenbach/Buchmann 2011: 41). Deutlich wird dies auch daran, dass er Partizipation und Engagement für andere als Verpflichtung zu sehen scheint, deren Erfüllung den Bürger und die Bürgerin auszeichnet und gegen die Oberschicht abgrenzt. Vor diesem Hintergrund ist also die Ansteckungskraft moralischen Handelns zu sehen, die Precht im Interview als seine Kernthese beschreibt:
Wenn meine Nachbarn, Freunde und Bekannte, wenn die [sich auch für andere einsetzen], werde ich mir komisch vorkommen, es nicht zu tun.
Dabei sieht er diese Ansteckung mitnichten nur auf die zwischenmenschliche Ebene der Familie, der Nachbarschaft oder des Freundes- und Bekanntenkreises beschränkt, sondern behauptet sie auch für die Beziehungen innerhalb der Staatengemeinschaft wie der Europäischen Union.
Welcher gesellschaftliche Fortschritt wurde jemals dadurch erzielt, dass sich 30 Länder auf etwas geeinigt haben? Das Kann nicht gelingen. Es fängt damit an, dass jemand anfängt. Moral entsteht durch Ansteckung und Kopieren — das ist zwischen Staaten nichts anderes als zwischen zwei Menschen.
Mit Blick auf die kulturelle Globalisierung ist das durchaus nachvollziehbar. Hier sind es aber gesellschaftliche Praktiken, die ggf. in Gesetze geschrieben werden (dazu bspw. Müller/Wager 2009). Dem liegt eine schwierige Vorstellung zu Grunde, der Precht nur bedingt gerecht wird: Das Zentrum der Macht ist leer. Wir werden nicht von den innovativen Gesetzen ‘der da oben’ gelenkt, sondern lenken ‘die da oben’ mit dem was wir als Mandate (auch abseits des turnusmäßigen Wahlgangs) an sie herantragen. Dass der Wirtschaftslobbyismus in den vergangenen 20, 30 Jahren mit seiner Vorstellung der “unsichtbaren Hand”, die alles zum Guten lenkt, wenn man sie nur lässt (frei nach Adam Smith), so erfolgreich war, liegt vor allem an der langjährigen Zurückhaltung zivilgesellschaftlicher Organisationen und dem massenhaften Rückzug der Bürgerinnen und Bürger ins Private (Dathe 2011: 42).
Wenn Precht also meint, “die Politik [hätte sich] Stück um Stück […] die demokratische Macht aus den Händen nehmen lassen“, spricht er damit jene leider nur all zu weit verbreitete Vorstellung gesellschaftlicher Dichotomie an, die es so einfach macht, anderen (denen da oben) die Schuld zu geben. Und bei der Politik macht Precht nicht halt. Auch die Schule sieht er in der Pflicht, die “erzieherischen Defizite“, die aus einer immer stärkeren Inanspruchnahme junger Eltern resultieren, “aufzugreifen und auszugleichen“. Nirgendwo sonst als in der Schule, meint er, können Kinder besser lernen, selbst bestimmt zu leben. Auch hierin steckt eine weit verbreitete Vorstellung: Die Institution Schule ist ein staatlicher Dienstleistungsbetrieb, dessen Leistungen bei Bedarf — bspw. mangelnder Kompetenzen der Eltern — abgerufen werden können; Eltern werden auf ihre Versorgungsleistung (Essen, Obdach, Zuneigung usw.) beschränkt und können den Lehrerinnen und Lehrern ruhigen Gewissens die Schuld geben, wenn ihren Kindern wichtige Kompetenzen fehlen.
Fazit
Richard David Precht verdient sich das Label Pop-Philosoph m.E. redlich. Viele seiner Aussagen gründen auf eben jenem Verständnis von sozialer Welt, das in seinem Publikum am weitesten verbreitet sein dürfte. Damit vermag er viele Menschen anzusprechen und in seinem Sinne aufzuklären, doch kann das eben auch Konsequenzen nach sich ziehen, die er so sicherlich nicht intendierte: So führt ihn der kommunitaristische Zugang zur Bürgergesellschaft bspw. zum Vorschlag eines sozialen Pflichtjahres für jung und alt (Ein mäßig provokanter Vorschlag, wie ich finde.). Mit einer solchen Verpflichtung, die ja nur top-down funktioniert, würde aber erstens die dichotomische Weltsicht (wir hier unten vs. die da oben) in den Milieus, in denen sie bereits besteht (bspw. im Prekariat) nur reproduziert. Zweitens würde das Engagement auf seinen (Hilfe) leistenden Charakter beschränkt und die tatsächlich Betroffenen, wie die so sehr beanspruchten Eltern, aus der Pflicht genommen. Und drittens könnten auch soziale Organisationen (die Nutznießer solch eines sozialen Pflichtjahres) genauso weiter machen wie bisher und ihren zivilgesellschaftlichen Auftrag in weiten Teilen irgnorieren. Ein Mehr an demokratischer Beteiligung — einen Wert den auch Precht nicht hoch genug zu halten kann — wäre damit jedenfalls nicht zu erreichen.
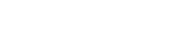
Frisch gebloggt: "Der Pop-Philosoph Richard David Precht im Stern" http://t.co/A3eB81gp #Philosophie #Zivilgesellschaft
RT @foulder: Frisch gebloggt: "Der Pop-Philosoph Richard David Precht im Stern" http://t.co/Ji6qBPbj #Philosophie…
RT @foulder: Frisch gebloggt: "Der Pop-Philosoph Richard David Precht im Stern" http://t.co/pA0pjI4T #Philosophie #Zivilgesellschaft
http://t.co/q8sK0cnD http://t.co/0wTJeaSE
In der aktuellen Stern-Ausgabe äußert sich der äußerst erfolgreiche Welterklärer Richard David Precht u. a. auch… http://t.co/BFnjw5IX
Da hat Herr #Precht wieder von seinen Verpflichtungsphantasien geredet: http://t.co/2bBsmlBA #annewill (siehe auch http://t.co/bW6vrHhw)