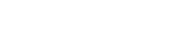Es macht gerade wieder die Runde: Freiwilliges Engagement hat positive Effekte auf die Gesundheit. Freiwillig engagierte Jugendliche — so hieß es kürzlich erst aus Kanada — hätten einen niedrigeren Cholesterinspiegel und einen besseren Body Mass Index. Aus den USA hieß es schon vor einer ganzen Weile, ältere Volunteers weisen eine niedrigere Mortalitätsrate auf als die Hilfeempfänger. „Fünffach positiver Effekt auf Ihre Gesundheit“ wird der Psychologie-Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer im BBE-Newsletter zitiert. Und, wenn man sich so anschaut, was der Herr Dr. Dr. da in der Zeitschrift Nervenheilkunde schreibt, scheint er recht zu haben: „Geben ist seliger als Nehmen (p < 0,5)“.
Ehrenamt macht gesund.
Spitzer (2006) stützt sich auf eine Studie von Brown et al. aus dem Jahre 2003. Die Wissenschaftler!nnen von der University of Michigan untersuchten seiner Zeit 423 ältere Paare über einen Zeitraum von fünf Jahren. Beleuchtet werden sollte die Verbindungen zwischen Sterblichkeitsrate, Geben und Nehmen.
- Welchen Einfluss hat das instrumentelle Geben (die konkrete Hilfeleistung) und die emotionale Unterstützung (z.B. Zuhören) auf die Gesundheit älterer Engagierter?
- Welchen Einfluss hat die instrumentelle oder emotionale Unterstützung auf jene, die die Hilfe empfangen?
- Wie lassen sich ggf. bestehende Zusammenhänge (Korrelationen) erklären?
Während des Untersuchungszeitraums verstarben 134 der insgesamt 846 Personen aus der Untersuchunsgsgruppe, sodass zunächst Aussagen zu den ersten beiden Forschungsfragen gemacht werden konnten. Dabei wurden hier sowohl die Variablen körperliche und seelische Gesundheit, gesundheitsrelevante Verhaltensweisen, Einkommen und Bildungsstand sowie Stress und Krankheitsdispositionen kontrolliert — heißt: Es wurde rechnerisch ausgeschlossen, dass diese Variablen mit dem Sterben oder Leben der Untersuchten etwas zu tun haben.
Im Ergebnis lässt sich eine reduzierte Sterblichkeit der freiwillig Engagierten um 54% (p < 0,05) und eine vermehrte Sterblichkeit von 23% (p < 0,01) bei jenen, die die Hilfe empfangen, nachweisen, wobei die Ausnahme bei Zweiteren die Empfängerinnen und Empfänger von emotionaler Unterstützung sind (p < 0,08). Auch freiwillige Engagierte Gesprächspartner zu haben ist also förderlich für die Gesundheit. Der Grund dafür — so Spitzer:
Wer in einem Netzwerk aus Menschen eingebunden ist, wer Kontakte knüpft und pflegt, kann auch und gerade dann, wenn es einmal nicht so gut um ihn steht, auf Unterstützung zählen. […] Schon lange ist bekannt, dass sich Menschen, die anderen helfen, vergleichsweise wohler fühlen und gesünder sind.
In der Tat: Bereits seit den 1990er Jahren gibt es immer wieder Autorinnen und Autoren, die auf eine bessere Gesundheit jener Menschen hinweisen, die in verlässliche Netzwerke eingebunden sind — die z.B. auch jemanden haben, bei dem sie den seelischen Ballast abladen können. In der eingangs erwähnten kanadischen Studie wird angeführt, dass freiwillig Engagierte häufiger einen geregelten Tagesablauf haben, während ihres Engagements ihr Selbstbewusstsein festigen und weniger schlecht gelaunt sind.
Alles in allem ist das freiwillige Engagement also vor allem deshalb gesund, weil man bei der freiwilligen Arbeit mit anderen zusammenkommt, Bekanntschaften, Freundschaften und Liebschaften eingeht. Ganz undifferenziert kann man hier durch aus von sozialen Netzwerken bzw. sozialem Kapital sprechen, das eben nicht nur — wie Pierre Bourdieu (1987: 2004) schreibt — dem eigenen Vorankommen, sondern auch der Gesundheit zuträglich ist. Wirken dürfte hier außerdem, dass freiwillig Engagierte kulturelles Kapital (z.B. Sozial- und Gremienkompetenzen) akkumulieren und deshalb nicht an der delierativen Funktionsweise westlicher Demokratien verzweifeln.
Die Argumentation für die These, Ehrenamt mache gesund, ist bestechend — bei Spitzer noch ein bisschen mehr als hier bei mir. Und doch ist Vorsicht geboten. Statistisch weisen Brown et al. nur Korrelationen nach — ein Phänomen und ein anderes stehen in einer (mehr oder weniger) starken Wechselwirkung zueinander. Die Kausalität zwischen diesen Phänomenen aber — die Wirkungsrichtung — wird konstruiert und kann durchaus falsch sein.
Mit der Flip-Flop-Technik hatte ich hier im Blog schon einmal eine Methode vorgestellt, mit der man Scheinkorrelationen auf die Schliche kommen kann. Da es sich hier aber nicht um eine Scheinkorrelation handelt — die Wechselwirkungen zwischen Ehrenamt und Gesundheitszustand ist (anders als bei Bahnschranken und Zugdurchfahrten) ja in der Tat anzunehmen –, muss eine andere Methode benutzt werden, die ich Übertragung nennen will. Übertragen werden soll der argumentative Umweg über die sozialen Netzwerke auf die These „Ehrenamt macht reich“.
Ehrenamt macht reich.
Ehrenamt ist zunächst einmal eine freiwillige und unentgeltliche Arbeit. Aufwandsentschädigungeng (auch pauschale) sind zwar üblich, machen aber sicherlich nicht reich. Ganz im Gegenteil: Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale in Verbindung mit Minijobs auf 400 EURO-Basis werden mithin als Vehikel für ausbeuterische Beschäftigungsverhältnissen benutzt. Und doch besteht ganz offensichtlich ein Zusammenhang zwischen Haushaltseinkommen und freiwilligem Engagement.
- Der deutsche Freiwilligensurvey zeigt, dass freiwillig Engagierte häufiger eine Arbeit haben als nicht Engagierte (Gesincke/Geiss 2010: 22). Der Unterschied in den Quoten ist am größten zwischen ALG II Empfängern und Teilzeitbeschäftigten (unter 35 Wochenstunden Arbeitszeit).
- Eine Auswertung des Schweizer Haushaltspanels zeigt, dass freiwillig Engagierte im Durchschnitt über 3.000 Franken im Jahr mehr verdienen als nicht Engagierte (Schlapbach 2009: 38f.). Der Unterschied zwischen engagierten nicht nicht engagierten Vollzeitbschäftigten fällt mit mehr als 9.000 Franken Unterschied im Jahreseinkommen noch deutlicher aus.
Auch ohne an dieser Stelle eine statistische abgesicherte Beweisführung vorlegen zu können, ist anzunehmen, dass es sich hier um eine hoch signifikante Korrelation zwischen freiwilligem Engagement, Berufstätigkeit und Haushaltseinkommen handelt. Eine Korrelation übrigens, die wie bei Brown et al. sehr wahrscheinlich auch noch bestehen bleibt, wenn potentiell intervenierende Variablen wie Bildung oder Gesundheitszustand kontrolliert werden. Zur Erinnerung: Bis zu dieser Stelle sprechen wir lediglich vom Auftreten zweier Phänomene zur gleichen Zeit. Nun gilt es die Kausalität nach obigem Vorbild zu konstruieren.
Zunächst sei der Einwand ausgeräumt, nicht freiwilliges Engagement führe zu einem guten Job und einem höheren Einkommen, sondern ein höheres Einkommen und der gute Job führe zu freiwilligem Engagement. Es scheint ja durchaus plausibel, dass man sich freiwilliges Engagement leisten können muss. Allerdings nehmen gut bezahlte Jobs ziemlich viel Zeit in Anspruch und lassen entsprechend weniger Raum für freiwilliges Engagement. Im oben zitierten Freiwilligensurvey zeigt sich ja auch, dass Teilzeitbeschäftigte etwas mehr engagiert sind als Vollzeitbeschäftigte. Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass sich die Teilzeitbeschäftigten noch auf dem Weg zu ihrem gut bezahlten Vollzeitjob befinden und dabei (richtiger Weise) auf freiwilliges Engagement setzen.
Es ist bekannt und bereits vielfach untersucht: Freiwillige knüpfen in ihrem Engagement Netzwerke aus ’nützlichen‘ Bekanntschaften, was man durch aus als Akkumulation sozialen Kapitals bezeichnen kann. Weiterhin erwerben Freiwillige in ihrem Engagement verschiedenste Kompetenzen, die sich wiederum als kulturelles Kapital fassen lassen. Beides, sowohl kulturelles wie auch soziales Kapital können in gewissem Maße in ökonomisches Kapital überführt werden (dazu Bourdieu 1983). Über Netzwerke aus Bekannten werden z.B. Jobs (auch gute) vermittelt und Teamfähigkeit, guter Umgangston und dergleichen sind nützlich, um im Berufsleben voran und die Karriereleiter nach oben zu kommen.
Was bleibt?
Es scheint durchaus als ließe sich die Argumentationslogik von Ehrenamt macht gesund auf Ehrenamt macht reich übertragen. Das freiwillige Engagement als Lernort verstanden, kann für jene, die darauf aus sind, ein Ort sein, an dem die wesentlichen Voraussetzungen für ein langes Leben und ein hohes Einkommen zu schaffen sind. Insofern stimmen die niedrigen Engagementquoten der Twens (vor allem der weiblichen) bedenklich. Starten diese doch gerade erst ins Berufsleben und könnten über ein freiwilliges Engagement noch bessere Voraussetzungen für ein hohes Ein- bzw. ein gutes Familienauskommen schaffen, was schließlich auch mehrfach positive Effekte für die Gesellschaft hätte: Junge Menschen kämen ins Engagement und zahlten später mehr Steuern.
Nun gilt aber nicht für alle Menschen gleicher Maßen, dass freiwilliges Engagement reich macht — genauso wenig wie es positive Wirkung auf aller Menschen Gesundheit hat. Arme, ausgegrenzte, benachteiligte Menschen, Menschen mit Bildungsdefiziten wie auch (junge) Menschen aus prekären Elternhäusern — das lässt sich auch aus dem zitierten Aufsatz von Pierre Bourdieu lesen — verfügen nicht über das „inkorporierte Kapital“, das für die Übertragung von (intentional Erworbenen) kulturellem und sozialen auf ökonomisches Kapital vonnöten wäre. Ebenso dürfte es sich mit der Gesundheit verhalten. Wer eigentlich keine Lust hat, sich zu engagieren, es aber trotzdem tut, weil’s der Arzt gesagt hat, wird sicher nicht glücklich und damit auch nicht gesund.
tl;dr: Traue keiner Kausalität, die du nicht selber kontruiert hast.