Hier mein Beitrag zur 15. Runde der NPO-Blogparade – diesmal in etwas anderer Gestalt. Brigitte Reiser von Nonprofits-Vernetzt fragt in dieser Runde, wie das Wissensmanagement in NPOs mit Social-Media-Tools gestaltet werden kann. Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Eine davon basiert auf der wenig neuen, provokanten oder bahnbrechenden Erkenntnis, dass die Wikipedia eine großartige Sache ist. Andere Möglichkeiten könnten neue Formate der Open-Space-Veranstaltungen (#Online-Web-Montag oder #SocialBar) oder diverse Mobil-Tools (#Twitter, #Buzz etc.) bieten. Allen diesen Tools ist aber gemein, dass es im Kern um den kommunikativen Umgang und Austausch unter Mitarbeitenden (hauptamtlich oder freiwillig) geht; um das ‚Social’ im Web also. Und eben dem will ich mich diesmal auf etwas essayistischere Weise nähern.
Die Weisheit der Vielen:
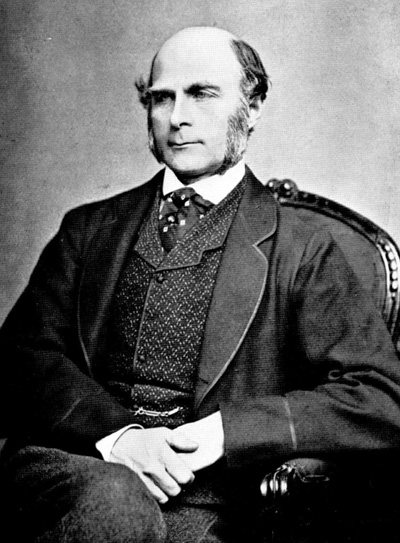 Dass das Kollektiv intelligenter ist als ein einzelner Mensch, ist schon seit langem bekannt. Francis Galton – der Erfinder des Galtung-Bretts – war es, der das zum ersten Mal zeigte; wenn auch unfreiwillig. 1906 führte er einen Ochsen auf den Markt und ließ dessen Gewicht von jedem schätzen, der sechs Pence dafür bezahlen wollte. Fast 800 Personen, darunter ausgewiesene Experten aber auch Laien, schätzten das Gewicht des Ochsen. Die meisten lagen wohl weit daneben – die einen drüber, die anderen drunter. Der Mittelwert aller Schätzungen aber wich nur wenig vom tatsächlichen Gewicht des Rindviehs ab. Auch wenn der werte Herr Galtung eigentlich die Dummheit der Vielen beweisen wollte, bewies er an deren statt, dass alle Schätzenden gemeinsam intelligenter waren als jeder für sich allein.
Dass das Kollektiv intelligenter ist als ein einzelner Mensch, ist schon seit langem bekannt. Francis Galton – der Erfinder des Galtung-Bretts – war es, der das zum ersten Mal zeigte; wenn auch unfreiwillig. 1906 führte er einen Ochsen auf den Markt und ließ dessen Gewicht von jedem schätzen, der sechs Pence dafür bezahlen wollte. Fast 800 Personen, darunter ausgewiesene Experten aber auch Laien, schätzten das Gewicht des Ochsen. Die meisten lagen wohl weit daneben – die einen drüber, die anderen drunter. Der Mittelwert aller Schätzungen aber wich nur wenig vom tatsächlichen Gewicht des Rindviehs ab. Auch wenn der werte Herr Galtung eigentlich die Dummheit der Vielen beweisen wollte, bewies er an deren statt, dass alle Schätzenden gemeinsam intelligenter waren als jeder für sich allein.
Eine schöne Geschichte, die ich gern erzähle, wenn es um die kollektive Intelligenz, die Weisheit der Vielen gehen soll. Ich habe dann immer das Gefühl, auf historisch begründeter Herleitung behaupten zu können „Gemeinsam sind wir stark“. Denn ich glaube dem ist auch so. Vielleicht konnten vor knapp 2500 Jahren noch einzelne Denker wie der gute Platon erstaunlich kreative Neuigkeiten ersinnen. In unserer Zeit aber brauchen wir dafür unsere Communitys; eben solche Gebilde wie die ‚scientifical community’ oder die ‚internet community’.
Was wären wir den heute ohne unsere Mitmenschen, ohne unsere Communitys, ohne unsere Netzwerke? Ich habe bis hier her noch nicht einmal 250 Worte geschrieben und schon dreimal bei einer namenhaften Websuche ‚gegoogelt’. Eine Technik, die ohne meine Mitmenschen, ohne die sog. Internet-Community und ohne das Computer-Netzwerk Internet nicht möglich wäre. Doch geht es hier natürlich nur um ‚Weltwissen’. Wissen, das man in der Wikipedia nachschlagen oder eben ergoogeln kann. Es geht noch nicht um Spezifika irgendwelcher Fachgebiete. Über die besteht über nämlich üblicher Weise Dissens. In deren Rahmen, so meinen besonders die Geistes- und Sozialwissenschaftler – ein beachtlicher Teil der NPO-Mitarbeitenden, würde ich sagen – lässt sich nicht einfach ein Durchschnitt bilden, der dann für wahr gehalten werden kann.
Das dem offenbar so ist, bestätigt auch ein kurzer Blick in die Wikipedia: Sucht man nach geisteswissenschaftlichen Lemmata wie bspw. „Kompetenz“, hat man sich zwischen mehreren neben einander stehenden Begriffen zu entscheiden: Da gibt es die Kompetenz im psychologischen Sinne, die Kompetenz im pädagogischen Sinne, die Kompetenz im sprachwissenschaftlichen Sinne, die Kompetenz im rechtswissenschaftlichen Sinne und sogar noch eine Sonderform – die Medienkompetenz. Ganz anders bei naturwissenschaftlichen Lemmata wie vielleicht „Algorithmus“. Bei dem gibt es einen Artikel, an dem seit Januar 2005 von ungeheuer vielen Usern gearbeitet wird. Nicht zig verschiedene relativ junge Artikel, die von viel weniger Leuten entwickelt werden.
Die oben genannte ‚Konsensscheue’ scheint mir also ein speziell geistes- oder sozialwissenschaftliches Problem zu sein. Das begegnet mir auch in meinem Studium der Bildungswissenschaften. Auch hier ist nicht wirklich klar, was der oder die Einzelne mit ‚Bildung’ überhaupt meint. Nicht das es keine Definition dieses Begriffes gäbe und das Wort deshalb formlos wie Schall und Rauch wäre. Es gibt zu viele und der Begriff sagt deshalb nichts. Hänge ich dem Thüringer Mönch Meister Eckart nach, müsste ich sagen, Bildung wäre die Formung des Menschen nach Gottes Ebenbild. Folge ich dem großen Hochschulreformer Wilhelm von Humboldt müsse ich Bildung als die dem Menschen aufgegebene Ausbildung seiner je individuellen Potentiale begreifen. Und glaube ich den ‚Followern’ Foucaults müsste ich mich von meiner ständigen Subjektwerdung emanzipieren. (Ein Projekt übrigens an dem sogar der Meister selbst scheiterte.) Einen Konsens, einen ‚state of the arts’, gibt es nicht; sehr zum Verdruss vieler Studierender. Dabei könnte man sich einen Solchen doch durchaus vorstellen.
Schaut man sich nämlich die oben genannten Wikipedia-Artikel zur Kompetenz näher an, fällt auf, dass alle im Kern eines zu meinen scheinen: Die Handlungsfähigkeit in dynamischen Systemen. Eine Definition, für die ich im Seminar zum Thema „Subjekt: Bildung und Gesellschaft“ eine deutliche Rüge kassierte. Denn auch hier ist der (kleinste gemeinsame) Konsens oder ein state of the arts noch in weiter Ferne. Natürlich – so hieß es – kann man das nicht so einfach sagen. Lieber diskutieren wir über etwas, von dem keiner weiß, was der oder die andere nun genau meint. Eben genau wie mit der Bildung – der Entwicklung eines Menschen in eine bestimmte Richtung.
Wenn es also die Kondensation eines Konsens aus unterschiedlichen Ansichten und Ansätzen ist, muss die Losung „Wissensmanagement“ heißen. Also das Management von Daten und Informationen für die Kultivierung von Kreativität und Wissen in Angriff genommen werden um eine Basis zu schaffen auf der sich aufbauen lässt. Wenn Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler davon ausgehen können, dass es etwas wie kollektives Wissen oder eine Art fließenden Konsens gibt – und das tuen sie – dann müsste sich das doch eigentlich auch auf die Wissenschaft und die verschiedenen Disziplinen selbst beziehen lassen. Warum auch nicht? Heißt es nicht, das wären auch nur Menschen?
Wo liegt also das Problem?
Durch die Lektüre einiger spannender Publikationen über die „schreckliche Wissenschaft“ und den „Tatort Universität“, bin ich vor nicht all zu langer Zeit auf einen witzigen Essay von Johan Galtung aufmerksam geworden.* Auch wenn dieser Aufsatz so alt ist wie ich selber bin, scheint er mir von seiner Aktualität wenig verloren zu haben. Jedenfalls beschreibt er anschaulich, was das Problem sein könnte. Es geht um intellektuelle Stile verschiedener Kulturkreise, deren Gegensätze, Schwächen und Stärken. Ganz konkret geht es um den angloamerikanischen, den japanischen, den französischen und den deutschen Stil des Umgangs Intellektueller untereinander. Der deutsche Stil – Galtung nennt ihn „teutonisch“ – interessierte mich natürlich besonders.
Vielleicht kennen die einen oder anderen die Comicfigur des unbesiegbaren Judo-Kämpfers, den die Gallier Asterix und Obelix auf dem Weg Rom zu unterwerfen besiegen mussten. Der Judoka Bombastik trug nämlich den Beinahmen „der Teutone“ und das nicht ohne Grund. Dieser kleine dicke Mann besiegte den großen und vor Kraft strotzenden Obelix immer und immer wieder, in dem er sich dessen größten Schwachpunkt zu Nutze machte – seinen Körperumfang. Nachdem Obelix geschwächt und frustriert aufgab, schaffte es nur der listige Asterix den übermächtigen Gegner zu einem bewegungsunfähigen Knäuel zu verknoten und das ohne einen Tropfen Zaubertrank.
Galtung meint, dass es sich mit den Teutonen genauso verhält. Sie machen sich auch die Schwäche des Gegners zu Nutze um ihn oder sie immer und immer wieder zu besiegen und schlussendlich derartig frustrieren, dass zukünftige Angriffe nicht mehr zu erwarten sind. Während angloamerikanische („sachsonische“) Intellektuelle immer das brauch- und verwertbare Goldkörnchen aus dem Referierten zu holen bemüht sind, auf Kollegialität statt auf Zweikampf setzten, aufbauen, nicht fertigmachen wollen, scheint die Geste des Schulter-Klopfens bei den Teutonen nicht sehr weit verbreitet.
„Niemand [wird sich] von seinem oder ihrem Weg abbringen lassen, nur um das kleinste Körnchen Gold zu finden, das kleine Element der Hoffnung, auf dem sich aufbauen ließe – im Gegenteil: die Diskutanten werden schnurstracks auf den schwächsten Punkt zusteuern“ (Galtung 1983, 309).
Blöd nur, das mithin auch die Studierenden als potentielle Gegner gesehen und auf gleiche Weise niedergerungen werden. Wer sich nicht in einem schon gebauten, anständig renovierten Theoriegebäude – Galtung meint es wären Pyramiden – bewegt, hat es schwer. Ein Umstand freilich, der die Produktion neuen Wissens und eine anerkennende Kultur der Innovation schon im Keim zu ersticken droht.
Und das eben nicht nur an Universitäten. Der allseits bekannte Soziologe Pierre Bourdieu meinte, dass wir unseren Stil, unser Gebaren, unseren Habitus nicht einfach so ablegen könnten. Einmal drin („inkorporiert“) müssen wir alles Andersartige mit äußerster Skepsis beäugen. Prallen verschiedene intellektuelle Stile aufeinander bedeutet das, dass auf die Kritik der jeweils anderen nicht adäquat reagiert werden kann. Da das Gebaren der jeweils anderen schlicht nicht in unsere Welt passt, machen wir es passend und formen es zu dem um, mit dem wir etwas anfangen können. Ganz getreu dem Motto: Was nicht passt wird passend gemacht. Das besagte Schulter-Klopfen bspw. kann so schnell als umfassende Anerkennung eines theoretischen Ergusses missverstanden werden, würdigt aber eigentlich nur den netten Versuch und will fragen:
„How do you operationalize this?” (Galtung 1983, 325)
Hauptsächlich stehen wir also vor dem Problem, dass wir die Fehlervermeidung und Pedanterie viel zu umfassend eingetrichtert bekommen. In der Schule und in den Jahren der Hochschule lernen wir alles zu vermeiden, was auch nur als Fehler gewertet werden könnte und neigen dazu das zu vertuschen, was uns wie ein Schwachpunkt vorkommt – sagen etwa ‘ich meine gelesen zu haben, dass …’ anstatt ‘in diesem oder jenem Buch steht geschrieben …’ Und das natürlich ohne prüfen zu können, ob es überhaupt ein Schwachpunkt ist. Eine Vermeidungstaktik freilich, die für das Aus-Fehlern-Lernen recht hinderlich ist.
Mögliche Lösung:
Man stelle sich vor: Ein Mitarbeiter auf dem Frankfurter Flughafen meint in einiger Entfernung etwas auf der Rollbahn liegen zu sehen. Ein Reifenteil vielleicht oder ein verendetes Tier. Egal was es ist, es muss sofort von der Bahn, weil sonst Menschenleben in Gefahr sein könnten. Er schlägt Alarm. Der Betrieb eines der größten Flughäfen Europas wird für Stunden lahm gelegt und ein Gros der Mitarbeitenden ist damit beschäftigt nach dem ominösen Ding zu suchen, dass sich schlussendlich dann doch als Fata-Morgana herausstellt. Was sollte nun wohl mit dem Mitarbeiter geschehen, der Alarm schlug? Nichts! Oder besser noch: Er sollte gewürdigt werden. Warum?
Sicherlich haben die Betreibenden des Flughafens und die Fluglinien viel Geld verloren – oder es gar nicht erst verdient. Würde aber auf einen solchen Fehler mit Strafe (Abmahnung, Kündigung o.ä.) reagiert, würden sich die Mitarbeitenden länger überlegen irgendetwas zu melden. Sie würden vielleicht auch meinen irgendetwas gesehen zu haben … vielleicht. Liegt dann wirklich ein Reifen auf der Rollbahn, sind zukünftig tatsächlich Menschenleben in Gefahr.
Das Beispiel hier habe erfunden. Dass es aber an Flughäfen ein fehlerfreundliches Management gibt und geben muss, ist kein Flachs. Ohne einen partizipativen, dialogorientierten Führungsstil und ausschließlich fall- und ereignisbezogenes Feedback, würden wir wohl viel häufiger von Unglücken an Flughäfen hören oder hätten uns mittlerweile schon daran gewöhnen müssen. Und eben hier sehe ich eine mögliche Lösung unseres Problems mit dem teutonischen Stil intellektuellen Zwei- oder Mehrkampfs.
Wenn NPO-Mitarbeitende damit rechnen könnten Anerkennung für ihre Arbeit zu bekommen, obwohl – oder gerade weil – sie sich hin und wieder trauen einen Fehler zu riskieren, dann würden regelmäßige Berichte via Blog und Ergänzungen und Weiterentwicklungen in Wikis (intern oder öffentlich) zur NPO-Normalität werden. Die morgendliche Lektüre der RSS-Feeds würde dann sicherlich auch die Selbstbeweihräucherung manchen Pressespiegels ersetzen und das Aus-Fehlern-Lernen so kollektiviert. Der gemeinsame Weg zu einem state ot the arts – wie er vielleicht im PflegeWiki oder den Bemühungen des ÖRK eine Social-Media-Policy zu erarbeiten zu erkennen ist – könnte so beschritten werden.
Um an dieser Stelle also klar auf die Frage Brigitte Reisers zu antworten: Meiner Ansicht nach sind es nicht unbedingt die Tools, die das Management von Daten und Informationen zur Kultivierung (oder auch zur Kollektivierung) von Wissen und Innovation begünstigen. Vielmehr sind es günstige Rahmenbedingungen, die eine Kultur des gemeinsamen Lernens ermöglichen. Im Rahmen einer umfassend anerkennenden Kultur der Fehlerfreundlichkeit, Neugier und Kollegialität sind sicherlich größere Lernfortschritte möglich als in einer Umgebung, in der jeder und jede tadellos geschliffene Rechnung über sein oder ihr tun ablegen muss.
* Ein treffendes Exerpt des Essays veröffentlichte Florian Dieckmann auf seinem Blog
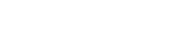
[…] Wertschätzung des unterschiedlichen Wissens der Kollegen (Hannes Jähnert, C. Henner-Fehr). Anderes/fremdes Wissen sollte nicht als Konkurrenz und Bedrohung betrachtet […]