Wie initiiere ich das? Wie starte ich meine eigene Community? Das war eine Frage im Workshop “Volunteering” auf der Fachtagung in Osnabrück, für die ich mir — abseits meiner Diplomarbeit, mit der ich eigentlich intensiv ringen sollte — kurz Zeit nehmen will. Im Workshop wollte ich nicht mit gefährlichem Halbwissen über Literatur glänzen, von der ich dachte, dass da was zu finden sein könnte. Aber ich wusste: Da war doch was!
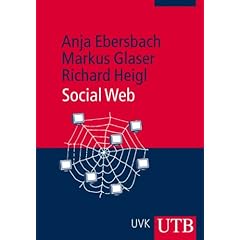 In dem recht aktuellen Handbuch “Social Web” (erschienen im Januar 2009) beschäftigen sich Anja Ebersbach, Markus Glaser und Richard Heigl in einem Abschnitt mit eben der Frage: “Wie starte ich meine eigene Community?” Die Autor(innen) stellen dabei gleich zu Beginn fest — und das kann eigentlich nicht überraschen –, dass sich Social Networks oder Online-Communitys nicht minutiös planen lassen.
In dem recht aktuellen Handbuch “Social Web” (erschienen im Januar 2009) beschäftigen sich Anja Ebersbach, Markus Glaser und Richard Heigl in einem Abschnitt mit eben der Frage: “Wie starte ich meine eigene Community?” Die Autor(innen) stellen dabei gleich zu Beginn fest — und das kann eigentlich nicht überraschen –, dass sich Social Networks oder Online-Communitys nicht minutiös planen lassen.
“Communitys zu ‘säen’ ist eigentlich eine kleine Kunst. Es bedarf eines ‘grünen Daumens’ und einer geeigneten Umgebung. Und selbst dann müssen die User mitspielen” (S. 195).
Zur Initiierung eines eigenen Social Networks braucht es also willige Userinnen und User und gute Rahmenbedingungen. Ich hatte im Workshop auf den Nutzen hingewiesen, ohne den niemand zur Teilnahme an einem — wie auch immer gearteten — Netzwerk zu bewegen ist.
Denn “Online-User denken weder an das Wohl der Community-Betreiber, noch denken sie überhaupt in Begriffen wie ‘Community'” (ebd.).
Ebersbach, Glaser und Heigl beschreiben aber ein paar elementare Grundregeln, die auch im Büchlein von Ebersbach et al. (2008). “Wiki. Kooperation im Web” zu finden sind.
- Die Mission: Auch die Autor(innen) sehen einen ganz praktischen und vor allem erkennbaren Nutzen für die Userinnen und User als Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz sozialer Software. Da auf die Nutzerschaft von Social Software natürlich auch Selbstorganisationsaufgaben zu kommen, die mit unter nur schwierig zu bewältigen sind (man denke an die gefühlte Anomie beim ersten Schreiben eines Wikipediaartikels) muss der in Aussicht stehende Nutzen die aktuellen Mühen überstrahlen.
- Das Ausmaß: Eine zweite Grundregel ist nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. “Die Größe macht den Unterschied” titeln Ebersbach, Glaser und Heigl hier. Ich brauche kein ausgewachsenes Wiki, wenn ich lediglich die Kooperation in einem kleinen Team via Social Software verbessern will. Zum einen — und das ist mein Einwand an dieser Stelle — frustrieren zu viele Funktionen und ein komplexes Layout, wenn es sowieso nicht genutzt wird (oder manchmal schlicht nicht richtig funktioniert) und zum andern — schreiben die Autor(innen) — das größere Netzwerke schwieriger zu kontrollieren sind als kleinere.
- Der Impuls: Auch wenn Social Software unter dem Lemma “User Generated Content” läuft, ist es doch sinnvoll zu Beginn einige Inhalte als Impuls bereit zu stellen, denn “eine leere Plattform bleibt auch eine leere Plattform”.
- Die Technik sozialer Software ist freilich nicht unbedingt die einfachste. Hier sollten sich Unternehmen eingehend beraten lassen und vielleicht auch in das Maßschneidern passender Open Source-Technik investieren, es gilt aber immer …
- Keep it Simple: Wie oben schon beschrieben, zu viele Features machen Social Software nicht besser sondern unübersichtlich, langweilig und frustrierend.
- Der Start: Durch den Einsatz der sog. Web 2.0-Technik ändert sich die Welt nicht — zumindest nicht von jetzt auf gleich. Im Social Web — so Ebersbach, Glaser und Heigl — ist der Aufbau von Vertrauen wichtig. Wird gleich zu Beginn eine harte Schiene gegen Querschläger gefahren, werden die Userinnen und User bald einen großen Bogen um die Community machen, die es dann eigentlich gar nicht gibt…
Ich denke also, dass wir mit unserem Diskussionsfazit ganz gut lagen, zunächst in einem kleinen Rahmen anzufangen, den Nutzen deutlich zu machen und so die Netzwerkpartner nach und nach an die Kommunikation via Social Software zu gewöhnen.
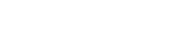
[…] (Auch über die Frage wie man ’sein eigenes Social Network’ aufbaut hatte ich hier im Blog schon […]