Das erste Semester meines Masterstudiums ist zu Ende. Im Oktober 2009 begann ich den „forschungsorientierten Masterstudiengang ‚Bildungswissenschaften — Organisation und Beratung’“ an der Fakultät eins der Technischen Universität Berlin. Eigentlich hatte ich mich auf den damals schon besser etablierten Masterstudiengang „Bildungsmanagement“ beworben, wurde zu meiner Überraschung aber für Bildungswissenschaften angenommen. Warum? Bildungsmanagement wurde schlicht nicht mehr angeboten.
Zunächst hatte ich den Eindruck, dass „Bildungswissenschaften“ die Beschreibungen im nun veralteten Modulkatalog auch besser trifft. In der Einführungsveranstaltung wurde aber schnell klar, dass — mit Ausnahme des Wahlpflichtmoduls „Medienbildung“ — zwar die Module aus dem alten Studiengang übernommen, Struktur und Ablauf dagegen stark verändert worden waren. Nach der dreistündigen Vorstellung aller Module, der Verantwortlichen und einer Hand voll freiwilliger Tutorinnen und Tutoren aus dem Vorgängerstudium, hatte ich schließlich das deutliche Gefühl in einer Art Testballon zu sitzen, der vielleicht irgendwann zum Ziel kommt, aber auch vom Winde verweht werden könnte. Um es anders auszudrücken: Wir wurden als Versuchskaninchen in der TUB herzlich aufgenommen.
Nun könnte man mich fragen, wieso ich der damals etwas verspäteten Annahme zum Masterstudiengang „Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen“ an der Humboldt Universität nicht nachgekommen bin. Ganz einfach: Mit der Entscheidung für eine akademische Laufbahn abseits der Sozialen Arbeit war es mir wichtig, die Methoden der empirischen Sozialforschung näher kennen zu lernen — und diese wurden im forschungsorientierten Studiengang Bildungswissenschaften explizit angeboten. Außerdem interessierten mich besonders rechtliche und organisatorische Aspekte der außerschulischen Bildungsarbeit (speziell Fort- und Weiterbildung). Obgleich mir also Chaos schwante, war ich froh mich an der TU Berlin eingeschrieben zu haben.
Am 19. Oktober 2009 starteten die Seminare des ersten Semesters. Geschult durch das sympathische Wahlpflichtchaos im Diplomstudiengang der Sozialen Arbeit in Erfurt, entschied ich mich zunächst, alle Seminare — so überfüllt sie auch immer waren — zu besuchen. Hier werden schließlich die Inhalte von den Professorinnen vorgestellt, die sie auch vermitteln. Das zumindest hatte ich mir so vorgestellt. Ein Gros Professorinnen aber, bei denen ich hoffte Seminare besuchen zu können, referierten — wenn überhaupt — lediglich die Moduleinführung.
Nun — dachte ich — sei’s drum. Bei Seminaren der einen oder des anderen Lehrbeauftragten war ich ja tatsächlich schon gut gefahren. Warum sollte das an der TUB anders sein? Im ständigen Austausch mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen stellte ich mir also meinen Semesterplan so zusammen, dass ich zum einen die Seminare besuchen konnte, die mich interessierten und mich zum andern nicht gleich im ersten Semester übernahm. Ob meines doch beträchtlichen Anfahrtsweges, war ich froh Seminare vor 10h vermeiden zu können und anständig lange Mittagspausen zu haben, in denen die Hauptmensa (10 Minuten Fußmarsch von der Fakultät Eins) eine Option war.
Im Sinne eines Semesterberichtes will ich hier der Reihe nach die Seminare schildern, die ich in meinem ersten Semester besuchte. Auf eine explizite Bewertung werde ich im Rahmen dieses Berichtes verzichten, weil diese meiner Ansicht nach nicht sachlich sein kann. Wem eine Bewertung dennoch wichtig erscheint, sei hier auf den Modulkatalog aufmerksam gemacht, in dem die Inhalte und Qualifikationsziele der einzelnen Module zu finden sind. Auch auf die namentliche Nennung der Lehrbeauftragten und Professorinnen verzichte ich in diesem Bericht, wer es aber dennoch genauer wissen will, dem sei das Vorlesungsverzeichnis dieses Wintersemesters 2009/10 ans Herz gelegt.
Recht und Organisation beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung
Vom ersten Seminar in meiner Woche versprach ich mir einiges. Das Recht und die Organisation beruflicher Fort- und Weiterbildung war schließlich einer meiner Interessenschwerpunkte und von daher auch Grund für die Wahl des Studiengangs. Das Seminar war eines von zweien, das ich aus drei Angeboten im Rahmen des Moduls „Berufliche Bildung“ auswählen konnte und lag auch zeitlich recht günstig — überschnitt sich nicht mit anderen Seminaren.
Entsprechend meinen erwähnten Erfahrungen mit dem sympathischen Wahlpflichtchaos in Erfurt, konnte mich der zunächst überfüllte Seminarraum wenig überraschen. Was mich allerdings überraschte, war die Vehements, mit der ein Gros der Seminarteilnehmenden auf der Vermittlung berufsschulorganisatorischer und -rechtlicher Inhalte beharrte. Inhalte, die mich zunächst überhaupt nicht interessierten. Warum auch; lag und liegt doch mein Interessenschwerpunkt auf Inhalten rund um die berufliche Fort- und Weiterbildung. Wie sich an dieser Stelle schon andeutet, setzte sich natürlich der größere Teil des Seminars gegen den kleineren durch, was dem Seminarleiter, dessen inhaltlicher Schwerpunkt ebenfalls die berufliche Ausbildung war, wohl auch ganz recht sein konnte.
Ein Lichtblick für mich war, dass auf eine Anwesenheitspflicht in diesem Seminar verzichtet wurde. Das bedeutete nämlich, dass ich mich nicht mit studentischen Referaten herumquälen musste, die mich nicht wirklich interessierten, hatte aber auch noch eine andere — milde ausgedrückt: ‘interessante’ — Auswirkung auf die Seminardynamik. Der Teil des Seminars nämlich, der sich so vehement für berufsschulische Inhalte eingesetzt hatte, bestand zu einem Großteil aus angehenden Berufsschullehrerinnen und -lehrern, die ob ihres sonstigen work-loads das Seminar, in dem nun ihre Wunschinhalte behandelt wurden, schlicht nicht mehr besuchten. So kam es also, dass sich der verbleibende Rest, inklusive meiner Wenigkeit, mit Inhalten beschäftigen musste, die ihn wenig bis gar nicht interessierten — eine Erkenntnis freilich, zu der ich als ungebrochener Optimist erst rückblickend kommen konnte.
Im Seminar sah ich gemeinsam mit einer Kommilitonin die Chance einer frühzeitig erbrachten Seminarleistung — eine Seminarleistung, die erfahrungsgemäß bewertungsstrategisch vorzuziehen ist. Wir erklärten uns daher bereit, ein studentisches Referat über „die historische Entwicklung der Berufsschule im Dualen System“ binnen einer Woche vorzubereiten. Das mit „Sehr Gut“ bewertete Ergebnis kann man sich hier im Blog anschauen.
Einführung in die Geschlechterforschung
Es wäre sicherlich übertrieben, würde ich behaupten, dass die Genderstudies die zweite Wahl gewesen wären. Ich interessiere mich schon seit vielen Jahren für dieses breite Themenfeld. Jedoch schaute ich mir auch das andere Wahlpflichtmodul zu „interkultureller Kooperation“ mit großem Interesse an. Internationale und interkulturelle Zusammenarbeit ist schließlich ein interessantes Feld, in dem ich sogar schon eigene Erfahrungen sammeln konnte (siehe Auswertung des Workshop Fit 4 Online-Volunteering auf der Volonteurope Conference 2009 in Sarajevo BiH). Da das Seminar aber zum einen zeitlich etwas ungünstig lag und mich zum anderen auch die Einführung nicht ansprach, entschied ich mich für das Wahlpflichtmodul zur Geschlechterforschung, was rückblickend auch eine sehr gute Wahl war.
Das Seminar wurde auf wöchentlicher Basis- und weiterführender Literatur aufgebaut. Jede Woche galt es andere Texte anhand verschiedener Literaturfragen durchzuarbeiten, was den Einstieg in die doch recht eigene Sprache der Geschlechterforscher_innen erleichterte. Im Seminar selbst wurden dann die Texte diskutiert, was zunächst natürlich ‘so Laberköppe’ wie mich auf den Plan rief, zunehmend aber auch zurückhaltendere Charaktere aktivierten konnte. Da ich mit meinen beiden Studiengang-Kommilitoninnen von Anbeginn ordentlich mitmachte, erschienen uns die Diskussionen zwar zunehmend redundant, doch für das Seminarziel, sich im Allgemeinen mit Genderstudies und im Speziellen mit einzelnen Fragen dieser zu beschäftigen, schien mir diese Seminargestaltung wirklich zielführend zu sein. Dass ich mich im Seminar auf jeden Fall zur eigenständigen Beschäftigung mit der Geschlechterforschung mitreißen ließ, macht wohl mein kleiner Essay über „Angela Merkel und die Macht der Bilder“ deutlich.
Einführung in die Berufs- und Wirtschaftspädagogik (BWP)
 Das Seminar „Einführung in die Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ war das zweite Seminar, das ich mir aus dem Angebot zum Modul „Berufliche Bildung“ ausgesucht hatte. Entsprechend meinen oben schon dargestellten Interessen, wollte ich mich hauptsächlich mit der Berufspädagogik im Feld der Fort- und Weiterbildung beschäftigen, was auch hier leider nicht ohne weiteres möglich war.
Das Seminar „Einführung in die Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ war das zweite Seminar, das ich mir aus dem Angebot zum Modul „Berufliche Bildung“ ausgesucht hatte. Entsprechend meinen oben schon dargestellten Interessen, wollte ich mich hauptsächlich mit der Berufspädagogik im Feld der Fort- und Weiterbildung beschäftigen, was auch hier leider nicht ohne weiteres möglich war.
Zwar war die Seminarliteratur, ein einführendes Werk in die Berufspädagogik von Rolf Arnold und Philipp Gonon von 2006, recht vielversprechend, doch kamen wir im Seminar nicht mehr zum Kapitel „Berufs- und Wirtschaftspädagogik in Studium und Praxis“ das mich vielleicht wirklich interessiert hätte. Stattdessen besprachen wir — meistens sprach der Seminarleiter — die grundlegenden Annahmen Arnolds und Gonons über BWP, die Historie der beruflichen Bildung inklusive des Für und Wieders eines Berufspostulates und — wen kann es überraschen — das duale System der Berufsausbildung in Deutschland.
Das häufig wiederkehrende Versprechen des Seminarleiters, wir würden unsere liebe Müh’ mit der Literatur haben und das Ausbleiben hilfreicher Lese- und Literaturfragen seinerseits frustrierte mich in diesem Seminar besonders. Da ich die Textabschnitte zu vielen Seminaren (wenn überhaupt) lediglich überflogen hatte, beschoss ich meine recht raren Diskussionsbeiträge weitgehend zu pointieren, was den Seminarleiter wiederum dazu motivierte, mir ans Herz zu legen „hier und da noch einen Satz mehr zu sagen“.
Schlussendlich bestand die Seminarleistung dann aus einer interessanten Form der mündlichen Gemeinschaftsprüfung. Für diese sollte jeder und jede eine kurze Zusammenfassung dreier kritischer Texte zum Dualen System referieren und Fragen zum Thema beantworten. Besonders wichtig schien dabei die Kenntnis des persönlichen Backgrounds der Autorinnen und Autoren, zumal unser Seminarleiter beinahe alle persönlich zu kennen schien.
Kommunikation und Kooperation
Das Seminar „Kommunikation und Kooperation“ war der erste Teil des Moduls „Kommunikation und Gesprächsführung“ und wurde von uns Studierenden weitgehend selbst gestaltet. Frei nach dem Motto „Lernen durch Lehren“ (LdL), ein eigentlich vielversprechendes Konzept der (Hoch-)Schulpädagogik von Jean-Pol Martin, bei dem die Lehrenden zu Regisseurinnen und Regisseuren der Lernprozesse ihrer Studierenden werden sollen, wurden in der ersten Sitzung Themen vergeben und diese in den folgenden Wochen abgehandelt. Da wir als Studierende aber jeweils die gesamte Sitzung gestalteten und bis auf die notwendige Präsentationstechnik (naturgemäß war das zumeist ein Beamer) und die jeweilige Grundlagenliteratur zum Thema keine weitere Unterstützung seitens der Seminarleiterin erhielten, vermute ich, dass sie Jean-Pol Martin bisher noch nicht kennt und wenn doch, ihn falsch verstanden hat.
Ich will nicht behaupten, dass ich mich im Seminar gelangweilt hätte. Die Präsentationen und Übungseinheiten, die Beispiele und Darstellungen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen waren zumeist sehr ansprechend. Leider aber fehlte jedwedes fachlich-qualifizierende Feed-Back, so dass mich zunehmend das Gefühl beschlich, man könne als Präsentierender alles erzählen, Hauptsache man stellt es ansprechend dar. Wenn auch nicht in voller Absicht, tat ich das dann auch. Mein Part in unserer Gruppe bestand darin, die grundlegenden Annahmen zu Sprachmanipulation nach Wolff von 1978 zu negieren und ihnen unter dem selben Label eine völlig andere These — nämlich die des Einsatzes von Sprache als Mittel unpersönlicher Herrschaft — entgegen zu halten. Rückblickend muss ich gestehen, dass meine Argumentation alles andere als bodenständig war und am Thema „Sprachmanipulation“ eigentlich vorbeiging. Aufgehalten oder auf diese Gewagtheit aufmerksam gemacht wurde ich jedenfalls nicht, nicht mal in der mündlichen Prüfung.
Ein Kommilitone fasste am Ende des Seminars treffend zusammen:
Er: “Eigentlich hätten Sie auch zu Hause bleiben können.”
Sie: “Stimmt”
Blockseminar zu Gesprächsführung und Beratung
Ich will hier einmalig von meiner Wochen-Plan-Reihenfolge abweichen, denn zum Modul „Kommunikation und Gesprächsführung“ gehörte auch das zweiteilige Blockseminar zur Gesprächsführung und Beratung, das ähnlichen Aufschluss bot. Da ich mich in meinem Studium der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik natürlich auch mit verschiedenen Gesprächsführungs- und Beratungsansätzen beschäftigt hatte, erwartete ich im Blockseminar zu diesem Thema nicht viel Neues. In der Vorbesprechung aber wurde dann auch Seminarliteratur zur tiefenpsychologischen Therapie angeboten, mit der ich mich noch nie eingehender beschäftigt hatte. Warum auch; weder bin ich Therapeut noch will ich einer werden. Um mich im Seminar aber doch noch mit etwas Neuem zu beschäftigen, wählte ich dieses Thema.
In der einleitend erw ähnten Vorstellung des Studiengangs und aller Verantwortlichen wurde angekündigt, dass dieses Blockseminar eine praxisorientierte Veranstaltung mit höchstens 15 Teilnehmenden sein sollte. Es sollten verschiedene Ansätze vorgestellt, ausprobiert und diskutiert werden. Ob diverser Kollisionen mit dem Nachbarstudiengang für Berufsschullehrerinnen und -lehrer konnte dieser Plan aber leider nicht aufrechterhalten werden. Das Bild hier spricht wohl Bände. Letztendlich verbrachten wir den ersten Teil des Blockseminars — zwei Tage, an denen die verschiedenen Beratungsansätze ‘vorgestellt‘, ‘ausprobiert‘ und ‘diskutiert‘ wurden — zu sechzigst in einem zunehmend stickiger werdenden Raum, was m.E. nach jede Praxisorientierung verhinderte.
ähnten Vorstellung des Studiengangs und aller Verantwortlichen wurde angekündigt, dass dieses Blockseminar eine praxisorientierte Veranstaltung mit höchstens 15 Teilnehmenden sein sollte. Es sollten verschiedene Ansätze vorgestellt, ausprobiert und diskutiert werden. Ob diverser Kollisionen mit dem Nachbarstudiengang für Berufsschullehrerinnen und -lehrer konnte dieser Plan aber leider nicht aufrechterhalten werden. Das Bild hier spricht wohl Bände. Letztendlich verbrachten wir den ersten Teil des Blockseminars — zwei Tage, an denen die verschiedenen Beratungsansätze ‘vorgestellt‘, ‘ausprobiert‘ und ‘diskutiert‘ wurden — zu sechzigst in einem zunehmend stickiger werdenden Raum, was m.E. nach jede Praxisorientierung verhinderte.
Im zweiten Teil des Blockseminars, dem Bindeglied zum Seminar „Kommunikation und Kooperation“, versuchten die Seminarleiterinnen auf das zu große Plenum zu reagieren. Ein großer Teil der Veranstaltung wurde in einen mittelgroßen Hörsaal des Mathematikgebäudes verlegt. Dort wurden dann von Praktikerinnen und Praktikern Gesprächsführungs- und Therapieansätze vorgestellt und anschließend mit den Teilnehmenden diskutiert. Auch wenn das Plenum für die notwendige Intensivdiskussion der Neurolinguistischen Programmierung* und des Coachings immer noch viel zu groß war, war es doch möglich, sich eingehend mit diesen Ansätzen auseinanderzusetzen. Die Seminarliteratur bestand schließlich aus mehreren Readern beträchtlichen Umfangs. Für die Vorbereitung meiner mündlichen Modulabschlussprüfung jedenfalls schwoll die Seminarreflektion und -diskussion über die vorgestellten Ansätze von geforderten fünf auf über elf Seiten Text an.
*Hier noch ein Artikel der GWUP über die ‘Wissenschaft’ NLP von Bördlein 2003
Bildung: Subjekt und Gesellschaft
Das donnerstägliche Seminar zu philosophischen und soziologischen Hintergründen der Debatte um Bildung und Kompetenz in unserer Gesellschaft, machte mir sehr viel Spaß. Auch wenn der Arbeitsaufwand für dieses Seminar, verglichen mit anderen Veranstaltungen, sehr groß war, freute ich mich doch fast jedes Mal, mehr über Rousseau, Humboldt, Bourdieu und viele andere zu erfahren.
Auch dieses Seminar war auf wöchentlicher Basis- und weiterführender Literatur aufgebaut, die dann in den einzelnen Veranstaltungen diskutiert wurde. Viel-Redner, zu denen ich mich ja oben schon gezählt hatte, hatten weite Teile dieses Seminars fest im Griff. Vielleicht lag es an Verständnisschwierigkeiten und den immer weiter führenden Diskussionen, dass sich nur einige meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen zur aktiven Teilnahme mitreißen ließen. Ansonsten wurde das eigentlich interessante Thema aber von starren und teilweise etwas gelangweilten Gesichtern verfolgt. Ausgehend von der Erkenntnis
„Die wenigsten Studierenden erstarren vor Ehrfurcht“
würde ich als gut gemeinten Vorschlag der weiteren Verbesserung des Seminars, Lese- bzw. Literaturfragen empfehlen, die die manchmal doch recht komplizierte Arbeit mit der Seminarliteratur erleichtern könnten.
Ein tolles Novum für mich waren die Seminar-Memos, die den jeweiligen Stand der Seminardiskussion festhielten. Ein Kommilitone, der gern mit dem Laptop mitschrieb, schickte seine Aufzeichnungen nach jedem Seminar an die Seminarleiterin, die sie berichtigte oder ergänzte und den anderen Seminarteilnehmenden zum Download oder sogar als Ausdruck bereit stellte. Was also in den einzelnen Seminaren besprochen wurde, wurde auf diese Weise dokumentiert und kann die Mitschriften, wenn nicht ersetzen, dann doch ergänzen. Toll!
Qualitative Bildungsforschung
Abschließend hier nun zum herausfordernsten Teil meines ersten Semesters: dem Modul „Bildungsforschung“. Ich hatte es oben geschrieben: Die Methoden der Sozialforschung hatte ich zu ein Schwerpunkt meines Masterstudiengangs erklärt. Sie waren einer der hauptsächlichen Gründe für die Wahl eben dieses Masterstudiengangs. Dementsprechend waren natürlich auch meine Erwartungen an das Seminarangebot sowie an mich selbst hoch.
Das Seminar zu „qualitativer Bildungsforschung“ war ähnlich aufgebaut wie das zu „Bildung: Subjekt und Gesellschaft“. Zu jedem Seminartermin gab es — teilweise recht komplizierte — Basis- und weiterführende Literatur ohne Literaturfragen, jeweils auf das letzte Seminar aufbauende Diskussionen und Memos bzw. Power-Point-Präsentationen zum Download. Ähnlich dem vorangegangenen Seminar aber auch starre, machmal gelangweilte Gesichter, in denen ich hin und wieder auch eine Regung ungläubigen Staunens zu sehen meinte, die ich selber verspürte.
Ungläubiges Staunen? Zu Recht! Hatte ich erwartet Ein- und Weiterführendes zu Interviewtechniken zu erfahren, vielleicht teilnehmendes Beobachten mal auszuprobieren oder etwas in der Art, lag der Schwerpunkt vor allem auf der hermeneutischen Interpretation dokumentierten menschlichen Miteinanders. Immer auf der Suche nach der latenten Struktur (einer zugrunde liegenden Grammatik aller menschlichen Interaktion) sezierten wir Texte, Tondokumente und Videoaufzeichnungen sequenziell und vermehrten eine halbe Zeile Interview zu Unmengen hochgradig wissenschaftlich anmutendem und entsprechend sprödem Textmaterial in dem ein „So-Und-Nicht-Anders-Gemeint“ wissenschaftlich bewiesen werden sollte. Angesichts dieser Pedanterie konnte ich mir endlich erklären, mit was die unzähligen Aktenordner in den Büros wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefüllt sein müssen.
Wie sich an dieser Stelle vielleicht vermuten lässt, war der work-load für dieses Seminar recht hoch. Insgesamt war der Heimarbeitsanteil aber etwa so groß wie die Präsenzzeit im Seminar, was den Vorgaben für das ECTS-Credit-Point-System etwa entspricht. Ein bisschen unvorteilhaft dabei war aber m.E. die Verteilung: Galt es zu Beginn ‘nur’ Texte zu lesen, wurden zum Ende des Semesters die Daumenschrauben angezogen. Zunächst galt es Tonmitschnitte zu transskripieren und inhaltlich zusammenzufassen, dann Videoausschnitte hermeneutisch auseinanderzunehmen und schließlich auch die eineinhalbstündige Modulprüfung vorzubereiten. Letzteres war wohl die bezeichnendste Ausschweifung: Gemäß der Feststellung Carl-Hellmut Wagemanns (emeritierter Professor für Hochschuldidaktik an der TUB), ein ‘Fach’ sei prinzipiell unendlich, standen auf der Liste prüfungsrelevanter Literatur mehr Texte, als wir in den Seminaren überhaupt hätten behandeln können. 18 Texte mit durchschnittlich 20 Seiten (macht 360 Seiten) standen 12 Präsenzseminaren gegenüber, in denen immer etwa die Hälfte der Basisliteratur besprochen werden konnte.
Quantitative Bildungsforschung
Ich muss gestehen, dass ich der quantitativen Sozialforschung schon vor Antritt meines Masterstudiengangs skeptisch gegenüberstand. In der Mathematisierung sozialer Welt sah und sehe ich eine zu weitgehende Abstraktion menschlichem Miteinanders und die Entkoppelung der Erkenntnis von menschlicher Realität. Call-Center, die ewige Warteschleifen mit immer gleicher Musik und teilweise horrenden Gebühren nur deshalb installieren, um allen als ‘unwichtig’ oder ‘nicht dringenden’ klassifizierten Anrufen der Kundschaft den Service zu verwehren, sind dafür wohl ein recht gutes Beispiel. Im Seminar zu „quantitativer Bildungsforschung“ sah ich nun die Chance, mich mit diesem Sachverhalt näher zu beschäftigen.
Was ich darüber hinaus von diesem Seminar erwartete, kann ich heute gar nicht so genau sagen. Sicherlich hatte ich neben der Beschäftigung mit dem eben genannten Problem auch das Handwerkszeug für eigene Datenauswertungen und damit auch die Kompetenz im Blick, Studien selbst kritisch bewerten zu können. Einen SPSS-Kurs ohne Alternativen allerdings hatte ich nicht erwartet.
Nach einer einführenden (quantitativen) Befragung der Seminarteilnehmenden und der gar nicht so abstrakten Erkenntnis, dass die Seminarleiterinnen einer äußerst heterogenen Gruppe gegenüber saßen, wurde das Seminar zu großen Teilen als Frontalunterweisung in die Geheimnisse des offenbar omnipotenten SPSS-Programms gestaltet. Bei Teilnehmenden wie mir, denen die Grundlagen der Statistik beinahe völlig abgingen, hielt sich der Lernfortschritt in entsprechend frustrierenden Grenzen, was die Aufmerksamkeit für eigentlich unwichtige Nebensächlichkeiten immer weiter erhöhte. So stachen mir bspw. Rechtschreibfehler ins Auge oder mir fielen unverständliche Erklärungen auf, die unter „Einfacher Ausgedrückt“ an die Wand gebeamt wurden. Nebensächlichkeiten, die mir sonst sicherlich egal gewesen wären.
Glücklicherweise erklärte sich einer unserer fortgeschritteneren Kommilitonen dazu bereit, ein fünfteiliges Tutorium zu den Grundlagen der vielen Verfahren abzuhalten, die im Seminar behandelt wurden. Anhand anschaulicher Beispiele und einfacherer Rechenaufgaben zeigte er, was denn eigentlich hinter dem t-Test, dem Kolmogorow-Smirnow-Test oder der Varianzanalyse steckte. So schwer schien es eigentlich gar nicht.
Ein weiteres Glück im Seminar war, dass die Prüfung — der zweite Teil des dreistündigen Modulabschlusses „Bildungsforschung“ — lediglich das Auswendig-Lernen der Seminarfolien zu Voraussetzung hatte. Auswendig-Lernen liegt mir eigentlich überhaupt nicht — wenn ich nicht sogar sagen müsste, dass es mir ein Graus ist. Da ich im Seminar aber nur verstanden hatte, dass quantitative Bildungsforschung weitgehender Mathematik-Schmu ist und sich mit dieser Erkenntnis wahrscheinlich in keiner Prüfung ein Blumentopf gewinnen lässt, war es diesmal doch eher Glück.
Fazit
Auch wenn einzelne Seminare meines ersten Semesters bei diesem Bericht vielleicht nicht all zu gut weggekommen sind, habe ich doch einiges gelernt. Manchmal zu Dingen, die mich nicht interessieren (Stichwort: Duales System), manchmal zu Dingen, die ich nicht erwartete (Stichwort: SPSS das omnipotente Tool). Mit Sicherheit aber habe ich in diesem ersten Semester an meiner Team- und Kritikfähigkeit gearbeitet (Stichwort: Kleingruppenarbeiten mit 7 bis 11 Studierenden). Auch meine ich, meinen Horizont um einiges erweitert und tiefere Einblicke in zuvor für banal Gehaltenes bekommen zu haben (Stichwort: objektiv hermeneutische Textinterpretation und die vollen Aktenschränke). Alles in allem kann ich also schon sagen, dass ich aus meinem ersten Semester einiges mitnehme; bleibt nur die Frage, welchen Anteil die besuchten Seminare an diesem Kompetenzzuwachs haben …
Mein subjektiver Eindruck: Wenige Seminare haben viel, viele Seminare wenig damit zu tun. Wollte ich hier nun diesen subjektiven Eindruck erhärten, müsste ich mir die Modulbeschreibungen der besuchten Seminare anschauen und sie mit meinen erworbenen Kompetenzen abgleichen. Wie schon einleitend geschrieben, will ich mir das gern sparen. Erstens, weil ich meine, dass eine derart zustande kommende Bewertung unsachlich werden müsste und zweitens weil ich denke, dass das lieber jeder für sich selber tun sollte. Was natürlich niemanden daran hindern muss, die Ergebnisse seiner / ihrer Reflexion in den Kommentaren kund zu tun.
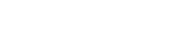

[…] April 6, 2010 Tags: Bildberichterstattung, Essay, Gender by Hannes Jähnert Wie hier und hier schon angekündigt, an dieser Stelle nun mein Essay über “Angela Merkel und die […]
Vielen Dank für deinen persönlichen und umfangreichen Rückblick auf das vergangene Semester. Habe alles interessiert bis zum Ende gelesen 😉
Da ich hier nicht noch eine weitere subjektive Reflektion des Semesters aufmachen will (auch wenn da einiges hinzukommen würde), beschränke ich mich mal auf die Ergänzung um kritischen Aspekte, die mir im Laufe des ersten Semesters besonders aufgefallen sind:
Abgesehen von der ein oder anderen inhaltlichen Unstimmigkeit (Psychoanalyse in einem Gesprächsführungsseminar, Beschränkung auf Ausbildung im Themenfeld berufliche Bildung) ist mir vor allem die teils schlechte Organisation im Studiengang aufgestoßen.
Als problematisch habe ich das vor allem im Modul “Berufliche Bildung” empfunden. Ich sehe ein, dass kurzfristige Planänderungen aufgrund von Krankheit zunächst zu Koordinationsschwierigkeiten etc. führen können. Dass aber beinahe die Hälfte aller Veranstaltungen in einem Modul ausfällt (zumindest in den 2 Veranstaltungen, die ich gewählt habe), da auf Privatdozenten zurückgegriffen werden muss, sehe ich sehr kritisch. Zumal auch nicht nach Ausweichterminen etc. gesucht wurde und oft nicht ganz klar war, ob die Veranstaltung nun stattfindet oder nicht.
Die organisatorischen Mängel wurden auch in dem von dir angesprochenen Blockseminar deutlich. Über die Verwunderung über die Gruppengröße auf Seiten der Seminarleitung war ich etwas erstaunt. Schließlich war das Seminar ja nicht nur Pflichtveranstaltung in unserem Masterprogramm, sondern auch bei den Berufsschullehrern, der Andrang also logischerweise vorprogrammiert. Dass die Qualität einer professionellen Begleitung von Rollenspielen (die in dem Themenkomplex unerlässlich sind) darunter leidet, ist wohl jedem klar. Das kann auch der Einsatz studentischer Hilfskräfte und Praktikanten nicht wirklich auffangen.
Im folgenden Semester zeigt sich die ungenügende Koordination in Überschneidungen von Veranstaltungen (wie im letzten Semester ja schon mit BWL). Wer also gerne sowohl Gender und Organisation als auch interkulturelle Bildungsarbeit belegen will (wie ich 🙁 ), hat ein Problem. Ich denke es sollte doch irgendwie möglich sein, Wahlpflicht-Veranstaltungen so zu koordinieren, dass es nicht zu Überschneidungen kommt, zumal es sich um die gleiche Fakultät handelt.
Neben diesen Aspekten hat mich aber vor allem die mangelnde Transparenz bzw. Kommunikation mit uns Studenten gestört. Angefangen bei der Klausurvorbereitung für das Modul der Methoden zur Bildungsforschung, bei der auf einmal (kurz vor knapp) ein ganzer Haufen bisher unbekannter oder wenig bis gar nicht besprochener Texte für qualitative Methoden als klausurrelevante Literatur auftauchte.
Oder aber, dass aus einer Informationsveranstaltung für unser Forschungsprojekt im Sommersemester mal eben eine Auftaktveranstaltung wurde, die deutlich machte, dass das Projekt eigentlich schon in den Ferien anfänglich bearbeitet werden sollte. An sich kein Problem, nur habe ich mir ja auch noch andere Pläne für die Ferien gemacht. Kann ja keiner wissen, dass eine Woche vor den Ferien dann noch das Forschungsprojekt dazu kommt. Zumal ich mir für diesen Zeitraum vorgenommen hatte, überhaupt erst einmal ein Thema und eine Organisation zu suchen. Nun musste ich mich innerhalb von einer Woche entscheiden, was ich gerne beforschen möchte und das während der intensivsten Klausurvorbereitungsphase.
Alles in allem kann ich mich dir aber auch nur anschließen, dass es ein spannendes Semester war und dass wenige Seminare viel und viele wenig damit zu tun hatten. Das trifft es wohl auf den Punkt!
Wir können gespannt auf das nächste Semester sein!
Ich kann euch, Hannes und Kathrin, voll zustimmen, und möchte nur ein paar Kleinigkeiten ergänzen:
Sollte das Seminar zu “Quantitative Bildungsforschung” nicht eigentlich auch vermitteln, wie man – ausgehend von bestimmten Hypothesen – zu einem möglichen Fragebogen kommt? Ich habe nämlich nun, im Rahmen unseres Studienprojektes, zu merken bekommen, was es heißt, (so gut wie) keine Ahnung von diesem Bereich zu haben. Für nachfolgende Studierende wäre es sicher hilfreich, auch und zuerst einmal diesen Aspekt der Bildungsforschung zu beleuchten, gerade im Hinblick auf die spätere Anwendung, die ja innerhalb des Studiums auf jeden Fall wichtig ist.
Zu diesem Seminar fällt mir sonst nur hin und wieder einmal die Szene ein, in der eine unserer beiden Dozentinnen nach gewisser Uneinigkeit mit ihrer Kollegin versuchte, die Varianz in ein mit einem phallusähnlichen Graphen versehenes Koordinatensystem einzuzeichnen – zur besseren Illustration dieses Begriffes. Unser fortgeschrittener Kommilitone schüttelte den Kopf und bemerkte nur: Die Varianz kann man nicht zeichnen!
Was ich bis heute noch nicht gänzlich durchschaut habe, ist, warum wir in diesem Studiengang für das Methoden-Modul überhaupt eine Klausur schreiben mussten. Denn diese war vor allem ein wunderbares Beispiel dafür, dass Klausur-Ergebnisse nicht wirklich etwas darüber aussagen, was Studenten verstanden haben, sondern was sie auswendig wussten (oder auch nicht wussten). Ich halte generell die Prüfungsform “Klausur” für unseren Masterstudiengang für diskussionswürdig: Wäre es nicht viel sinnvoller Hausarbeiten schreiben zu lassen? Dabei hätte ich jedenfalls mehr gelernt als durch diese Klausur.
Bezüglich des Gesprächsführungs-Blockseminars: Wie auch immer diese Veranstaltung geplant war – über die verschiedenen Gesprächsführungsansätze habe ich am meisten erfahren, als ich mich am Ende des Semesters zuhause hingesetzt habe und in Eigenregie recherchiert habe, um mein Reflexionspapier zusammenzubasteln. Denn hätte ich nur reflektiert, was in diesem Seminar tatsächlich gelaufen ist, dann wäre ich bei irgendwelchen Taxi-Fahrer-Übungen gelandet, aber ganz sicher nicht dabei, was den klientenzentrierten Ansatz (der sich in der Literatur übrigens treffender als der “personenzentrierte” Ansatz verstanden wissen will) als solchen ausmacht. Ehrlich gesagt: Ich war mir am Ende des Semesters gar nicht mehr sicher, ob wir zu diesem Ansatz überhaupt irgendetwas besprochen hatten. Fazit: Dieses Seminar hat einen jedenfalls zum eigenständigen Recherchieren veranlasst.
Zum Abschluss noch die Frage: Warum tun sich gerade die Dozenten, deren Lehrveranstaltungen hier häufig als verbesserungswürdig angesprochen wurden, so schwer, eine abschließende Evaluation durchzuführen, wie das in anderen Studiengängen der Fall ist? – Und dies vor dem Hintergrund unseres Studienfaches (so viel zum Thema “Optimierung von Bildungsprozessen”…). Ich schätze, dass insbesondere für den quantitativen Teil des Methodenmoduls ein Feedback um einiges weiterhelfen könnte.
Für die Zukunft: Es bleibt spannend!
[…] hier und hier schon angekündigt, an dieser Stelle nun mein Essay über “Angela Merkel und die […]