„Bund, Länder und Kommunen sind zentrale Akteure in der Engagementförderung.“ Diesen Satz aus der Nationalen Engagementstrategie unserer Bundesregierung versteht Brigitte Reiser als den wichtigsten dieses Kabinettsbeschlusses. Zwar bleiben traditionelle Verbände des Dritten Sektors „wichtige Partner der Bundesregierung im Bereich der Engagementpolitik“ doch soll die öffentliche Verwaltung nun die zentrale Rolle in der Förderung von Engagement und Partizipation spielen. Eine große Herausforderung, besonders für die kommunale Verwaltung.
Obgleich ich diesen Beschluss der Bundesregierung sehr kritisch sehe, will ich an dieser Stelle gern eine zentrale Herausforderung aufzeigen, vor der der öffentliche Verwaltung wie auch NPOs stehen: der Frage nämlich, wie die Kommunikation mit den jeweiligen Stakeholdern in Zukunft gestaltet werden kann.
 Gerald Czech fragt in der aktuellen Runde der NPO-Blogparade nach dem „Wie, Was, Wann und Warum“ einer Social Media Policy. Als Co-Host erweiterte ich diese Fragestellung um eine überorganisationale Perspektive, die die Diskussion um die Frage der Dos und Don’ts innerhalb der Organisation auf die Stakeholder ausweitet. Damit will ich nicht behaupten, dass sich der Diskurs um eine organisationale Policy für den Umgang mit Social Media per se auf die freiwillig und hauptamtlich Mitarbeitenden beschränken muss. Die vorbildliche Social Media Policy des Österreichischen Roten Kreuzes wurde schließlich in einem offenen Wiki erarbeitet, an dem auch Außenstehende mitarbeiten konnten, die sich nicht als Teil des ÖRK verstehen. Und dennoch gehe ich mit der Frage, wie wir künftig mit einander reden wollen, einen Schritt weiter. Ich ziele damit nicht nur auf die theoretische Möglichkeit den Diskussionsprozess zu beeinflussen, sondern forciere vor allem das Empowerment der Stakeholder sich dabei aktiv einzubringen.
Gerald Czech fragt in der aktuellen Runde der NPO-Blogparade nach dem „Wie, Was, Wann und Warum“ einer Social Media Policy. Als Co-Host erweiterte ich diese Fragestellung um eine überorganisationale Perspektive, die die Diskussion um die Frage der Dos und Don’ts innerhalb der Organisation auf die Stakeholder ausweitet. Damit will ich nicht behaupten, dass sich der Diskurs um eine organisationale Policy für den Umgang mit Social Media per se auf die freiwillig und hauptamtlich Mitarbeitenden beschränken muss. Die vorbildliche Social Media Policy des Österreichischen Roten Kreuzes wurde schließlich in einem offenen Wiki erarbeitet, an dem auch Außenstehende mitarbeiten konnten, die sich nicht als Teil des ÖRK verstehen. Und dennoch gehe ich mit der Frage, wie wir künftig mit einander reden wollen, einen Schritt weiter. Ich ziele damit nicht nur auf die theoretische Möglichkeit den Diskussionsprozess zu beeinflussen, sondern forciere vor allem das Empowerment der Stakeholder sich dabei aktiv einzubringen.
Als zentrale Herausforderung sehe ich eben dieses Empowerment zur Partizipation. Es kann m.E. nicht darum gehen zwar öffentlich aber weitgehend unbeobachtet einen Konsens weniger Akteure zu produzieren, der dann allen vor die Nase gesetzt wird. Eben das ist aber der modus operandi von Handlungsanweisungen in der öffentlichen Verwaltung, wie auch der in vielen traditionellen Organisationen. Besonders Verwaltungsvorschriften definieren sich ja durch die Anweisung einer übergeordneten Stelle an eine nachgestellte Einheit und sind insofern Meilen von partnerschaftlichen Konsensen entfernt. Dabei könnte man nun einwenden, dass sich Verwaltungsvorschriften gemäß dieser Definition ausschließlich auf das Innenrecht, also die Verwaltung selbst beziehen und nur mittelbar auf die Bürgerinnen und Bürger wirken. Das ist sicherlich auch richtig, doch reicht schon diese Mittelbarkeit bei der Kommunikation mit den Stakeholdern aus, um an dieser Stelle ansetzen zu können.
Handlungsanweisungen, egal ob in der öffentlichen Verwaltung oder in NPOs, liegen immer implizite Annahmen zu Grunde (bspw. Alle Welt liest Zeitung / Junge Menschen erreichen wir über Facebook / Was wir sagen interessiert ohnehin niemanden usw.). Werden diese Annahmen nicht an der Realität überprüft und mit den Stakeholdern verhandelt – und auch immer wieder neu verhandelt – werden über kurz oder lang nur noch diejenigen erreicht, die willens und fähig sind, sich auf die Vorgegebenen Modi der Kommunikation einzulassen. Gerade solch lavierende Aussagen wie „Sie müssten ja ‚nur’ an der richtigen Stelle nachschauen“ steht dem Empowerment, zu dem Bund, Länder und Kommunen, die nunmehr die „zentralen Akteure in der Engagementförderung“ sein sollen, aber entgegen.
Ein Vorschlag, der auch in der Arbeitsgruppe zu „Engagement und Partizipation im Internet“ des BBE diskutiert wurde, besteht darin, zumindest auf kommunaler Ebene einen Bürgerdialog über die Frage öffentlicher Kommunikation und Information anzustoßen. Es geht um die scheinbar einfache Frage „Wie wollen wir miteinander reden?“
Natürlich bin ich persönlich sehr dafür, einen Newsfeed mit tagesaktuellen Informationen aus der Verwaltung jener Kommune zu bekommen, in der ich lebe. Gern hätte ich die Informationen auch übersichtlich auf einer Karte dargestellt, wie es bei Frankfurt Gestalten geschieht. Doch weiß ich eben auch, dass ich (noch) einer der wenigen bin, die mit RSS-Feeds, Geo-Mapping und all den anderen durch aus vielseitigen Möglichkeiten des Web 2.0 umgehen kann und will. Dementsprechend kann ich bei einem Bürgerdialog im oben angedachten Sinne nicht von vornherein davon ausgehen, dass sofort alles auf Social Media (mit entsprechender Policy) umgestellt wird. Damit würden schließlich wieder ‚nur‘ diejenigen erreicht, die willens und fähig sind, sich auf diese Modi der Kommunikation einzulassen. Ein Gang der Dinge, der wohl eher zu erwarten ist, ist, dass sich verschiedene Lager bilden, die für das Eine (Social Media), das Andere (herkömmliche Information via Anzeiger usw.) oder alles auf einmal (Open Data?!) plädieren. Welche Entscheidungen aber auch immer am Ende eines solchen Prozesses stehen, kann und darf nicht von vorn herein bestimmt werden. Angedacht ist schließlich ein wirklich ergebnisoffener Prozess, der auch entsprechend Moderiert wird.
Ich plädiere hier nicht das erste Mal für echte – wirkungsmächtige – Partizipation, bei der die Bedürfnisse aller Dialogpartnerinnen und -partner (und hier schließe ich ausdrücklich die der öffentlichen Verwaltung und der NPOs mit ein) ernst genommen werden. Zuletzt hatte ich geschrieben, dass echte Partizipationsofferten – ob nun mit Social Media Tools oder ohne – Wirkungsmacht erwartbar machen müssen. M.E. sollte tunlichst verhindert werden, Interessierte mit vermeintlicher Folgenlosigkeit abzuschrecken, da so auch die allen Ortens forcierte Ausbilung einer aktiven Zivilgesellschaft verhindert wird.
Konzeptionell stell ich mir drei wichtige Eckpunkte eines solchen Beteiligungsprozesses vor, die es mit erfahrener Expertise aber noch weiter auszubauen gilt:
- Die Diskussionspartnerinnen und -partner müssen die Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens repräsentieren können. Eine Teilnahme auf der Basis von (Frei-)Willigkeit und Fähigkeit würde andernfalls schon von vorn herein diejenigen ausschließen, die auch schon vorher nicht erreicht wurden.
- Die Verteilung von zeitlichen und finanziellen Ressourcen der kommunalen Verwaltung müssen im Prozess bedacht und diskutiert werden (Bürgerhaushalt). In Zeiten oft kommunizierter leerer Kassen würde eine Beteiligung á la „Wünsch dir was“ sonst von den meisten Teilnehmenden nicht wirklich als wirkungsmächtig ernst genommen werden können.
- Der Dialog muss tatsächlich ergebnisoffen geführt werden. Alle Seiten sollten sich darüber im Klaren sein, dass im Laufe dieses Prozesses ein Kompromiss ausgehandelt werden soll, mit dem alle Beteiligten gut leben können. Ein kompromissloses festhalten an der eigenen Meinung würde hier sehr kontraproduktiv wirken.
- Ein solches Beteiligungsverfahren nur einmal zu führen reicht nicht aus. Der Diskurs um die Frage, wie wir miteinander reden wollen, muss regelmäßig geführt werden. Was das allerdings im Einzelnen heißt, muss jeweils verhandelt werden.
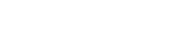
frisch gebloggt: Mein Beitrag zur aktuellen Runde der #npoblogparade: http://bit.ly/iPqDf7 Wo bleibt der Rest?
[…] Rücklauf. Nur der Co-Host Hannes Jähnert, der diese Erweiterung angeregt hatte, ging in seinem Beitrag näher auf mögliche Eckpunkte eines Beteiligungsprozesses auf kommunaler Ebene ein. Die übrigen Beiträge kreisten also um mehr oder minder grundsätzliche Fragen zu und die […]