Anerkennung, so heißt es, ist der Lohn für das freiwillige Engagement und da ist sicher auch etwas dran. Zwar ist freiwilliges Engagement per Definition unentgeltlich – meint: nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet – doch heißt das nicht, Freiwillige würden nichts von ihrem Engagement erwarten. Bereits ein Blick in den Freiwilligensurvey zeigt unterschiedlichste Erwartungen, die heute an ein Engagement herangetragen werden. Das freiwillige Engagement soll Freude bereiten beziehungsweise Spaß machen. Es soll anderen Menschen helfen und etwas zum Gemeinwohl beitragen. Viele Freiwillige wollen auch einfach mit sympathischen Menschen zusammenkommen, ihren Horizont erweitern und die eigenen Fähigkeiten ausbauen.
Zwar sind die Erwartungen an ein freiwilliges Engagement in den letzten Jahren immer konkreter geworden, doch haben sich auch diversifiziert (siehe dazu Jähnert/Breidenbach/Buchmann 2011). So sind es zum Beispiel eher ältere Freiwillige, die mit anderen Generationen zusammenkommen wollen. Jüngere Engagierte streben dagegen eher einen Kompetenzgewinn durch ihre Freiwilligentätigkeit an. Und es sind wohl auch eher Männer, die ihre eigenen Interessen vertreten und eher Frauen, die mit ihrem Engagement anderen Menschen helfen wollen (das zumindest zeigt die Geschlechterverteilung in den unterschiedlichen Engagementbereichen). Wenn die Anerkennung der Lohn für freiwilliges Engagement sein soll, sollten sich Freiwilligenorganisationen zunächst in der Pflicht sehen, die wandlungsfähigen Erwartungen ihrer Freiwilligen zu erfüllen.
Gegenleistungen für freiwilliges Engagement
Leider gelingt das nicht immer. Häufig – und den aktuellen Daten zu materiellen Gegenleistungen im freiwilligen Engagement zu folge immer häufiger (Gensicke/Geiss 2010: 257ff.) – wird freiwilliges Engagement als eine Art Dienstleistung missverstanden, die dank des guten Willens der Engagierten relativ preiswert zu haben ist. Nicht selten wird versucht, Freiwillige mit Geld und Sachleistungen bei der Stange zu halten. Besonders pauschale Aufwandsentschädigungen (Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale) haben mit der Einführung des „Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ vom 10. Oktober 2007 seit 1999 zugenommen.
Und auch die durchaus üblichen immateriellen Gegenleistungen wie öffentliche beziehungsweise öffentlichkeitswirksame Würdigungen, kleinere Gefälligkeiten wie Empfehlungen oder sehr gute Beurteilungen sowie Geburtstags- und Jubiläumsglückwünsche weisen darauf hin, dass die im Freiwilligenmanagement so hoch gehaltene Anerkennungskultur das freiwillige Engagement eher als Tauschgeschäft denn als aktive Form zivilgesellschaftlicher Teilnahme konzipiert. In ihrem Beitrag zu „Anerkennung zwischen Tauschgeschäft und Philosophie“ zeigt Julia Russau diese – mindestens latente – Dienstleistungsmentalität anhand der „best practises“ Beschreibung von Anerkennungskultur, die sie auf der Webseite des Projekts „Civitas – Bürgerorientierte Kommunen in Deutschland“ gefunden hat:
Anerkennungskultur
Auf die Freiwilligenarbeit angewandt ist Anerkennungskultur die Gesamtheit dessen, was zur Anerkennung beiträgt. Dies als Philosophie zu bezeichnen, entspräche nicht der Realität. Denn Engagierte brauchen mehr als abstrakte Denkformen, sie brauchen anschauliche, erlebbare Formen der Anerkennung. Anerkennungskultur besteht aus vielen einzelnen Teilen. Anerkennungskultur ist eine Ermöglichungshaltung.
In der Tat wird Anerkennungskultur hier als ein formloses Etwas (die Gesamtheit dessen, was zu Anerkennung beiträgt) entworfen, das für die Adressaten unmittelbar erlebbar sein (über abstraktes hinausgeht) und sie im Engagement halten soll. In der Tat wird die Anerkennungskultur hier als ein Entlohnungssystem konzipiert, womit das freiwillige Engagement zu einer Art Erwerbsarbeit umdefiniert wird. Wenngleich Freiwillige für ihr Engagement keine finanziellen Gegenleistungen erhalten, sollen sie für ihre Arbeit doch etwas bekommen – wenn möglich in anschaulicher, erlebbarer, also ‚abrechenbar‘ Form.
Auswirkungen der ‚Entlohnung‘ freiwilligen Engagements
Bereits aus sozialphilosophischer Perspektive auf freiwilliges Engagement als Ausdrucksform der Belange, die sich in den jeweiligen Lebensumfeldern der Freiwilligen finden, ist diese Nähe zur Erwerbsarbeit schwierig. Die Kritik ist bekannt: Wer auf materielle oder immaterielle Gegenleistungen aus dem freiwilligen Engagement angewiesen ist – und sei es nur ein gutes Empfehlungsschreiben – wählt den Ort und die Form seines Engagements nicht mehr nach eigenen Prämissen, sondern nach denen anderer aus. Das Engagement wird damit fremdbestimmt und seiner eigentlichen Stärke, die Belange aus den privaten Lebensbereichen in die politische Öffentlichkeit zu tragen, beraubt.
Interessant ist nun, dass die Nähe freiwilligen Engagements zur Erwerbsarbeit auch aus der Perspektive der Arbeitspsychologie einiger Kritik würdig ist. Theo Wehner, Leiter der Forschungsgruppe Psychologie der Arbeit in Organisation und Gesellschaft an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, referierte hierzu auf der ÖRK-Konferenz „Neue Formen der Freiwilligenarbeit“ in Krems an der Donau. In seinem Vortrag zeigte er, dass „frei-gemeinnützige Arbeit“ von den Engagierten selbst nicht als Form der Erwerbsarbeit verstanden wird. Freiwilliges Engagement hat Wehner und seinen Kolleg!nnen zu folge eine andere Sinn- und Motivstruktur als die Erwerbsarbeit. Während letztere von den Befragten eher als anstrengend, notwendig und verpflichtend verstanden wurde, wurde das freiwillige Engagement eher als angenehme, intrinsisch motivierte Tätigkeit mit anderen verstanden (siehe dazu Mösken/Dick/Wehner 2009). Auch hier wird also deutlich, dass die Metapher vom Lohn für freiwilliges Engagement dessen Eigensinn verkennt. Wenn das angenehme Gefühl etwas mit anderen für andere zu machen ein wesentlicher Teil der Sinn- und Motivstruktur freiwilligen Engagements ist, kann dessen Fehlen nicht mit materiellen oder immateriellen Gegenleistungen ausgeglichen werden, ohne freiwilliges Engagement ein Stückweit zu Erwerbsarbeit zu machen und damit seiner Attraktivität zu berauben.
Und auch noch eine weitere Untersuchung, die Wehner in seinem Vortrag erwähnte, weist darauf hin, dass Anerkennung als Gegenleistung freiwilliges Engagement nicht unbedingt ‚besser‘ machen muss. Stefan Güntert war so freundlich, mir den entsprechenden Auszug aus seiner Dissertation zu übersenden, in der er „relevante Einflussfaktoren auf die intrinsische Motivation Freiwilliger“ erforschte. Auf der Grundlage des Job Characteristics Model von Hackmann und Oldham (1976) geht er dabei der Fragestellung nach, wie sich die Anerkennung und Wertschätzung seitens der Organisation und die seitens der Empfänger der Hilfeleistung auf die Zufriedenheit der Freiwilligen mit ihrem Engagement auswirkt (Güntert 2007: 80f.).
Bemerkenswert ist hier, dass sich die Zufriedenheit der Freiwilligen mit ihrem Engagement vor allem durch die Vielfalt herausfordernder und bedeutsamer Tätigkeiten, durch die Rückmeldung aus der Tätigkeit selbst und durch die Anerkennung seitens der Empfänger von Hilfeleistungen erklärt. Die Anerkennung und Wertschätzung seitens der Organisation wird von den Freiwilligen dagegen eher als „belastendes Gefühl der Verpflichtung“ empfunden (ebd.: 113f.). Damit wird die Anerkennung seitens der Organisation aber nicht obsolet. Güntert zu folge macht die Trennung der Zufriedenheit Freiwilliger mit ihrem Engagement von ihrer Verbundenheit mit der Organisation durchaus Sinn (ebd.: 138). Zwar wird die Anerkennung und Wertschätzung seitens der Organisation ähnlich „erlittener Bürokratie“ als belastend empfunden, doch wirkt sie eben auch positiv auf die Verbundenheit.
[Güntert] erscheint es durchaus plausibel, dass gerade bei starker Eingebundenheit in die Organisation ein großes Ausmaß an Anerkennung nicht nur als Dankbarkeit, sondern auch als Verpflichtung von den Freiwilligen erlebt wird. Angesichts des Eindrucks, dass Diskussionen rund um das Thema der Anerkennung freiwilliger Arbeit selten von Freiwilligen selbst initiiert werden, sondern eher von den Organisationen, die auf die Mitarbeit Freiwilliger angewiesen sind, darf an dieser Stelle der Verdacht geäußert werden, dass es weniger darum geht, den Freiwilligen etwas Gutes anzutun, als vielmehr um eine stärkere instrumentelle Bindung der Freiwilligen an die Organisation (ebd. 2007: 139).
Damit bestätigt Güntert zunächst den Verdacht, dass freiwilliges Engagement seitens der Trägerorganisationen eher als eine besondere Art der Erwerbsarbeit oder eben als Tauschgeschäft verstanden wird, legt allerdings auch nahe, diesen Schluss nicht allzu düster zu interpretieren. Eine gewisse Verbundenheit mit der Organisation und das damit einhergehende stete Engagement können schließlich auch positiv auf die Zusammenarbeit der Freiwilligen untereinander und damit auf die angenehmen Seiten des freiwilligen Engagements wirken. Dennoch bleibt die Befürchtung, dass das freiwillige Engagement so strukturell an die normale Erwerbsarbeit herangerückt wird, was Mösken, Dick und Wehner (2009: 22ff.) zu folge eher abschreckend den ermöglichend wirkt.
… und nun?!
Es ist wohl an der Zeit, den Begriff der Anerkennung und die entsprechenden Kulturpraktiken zu überdenken. Besonders jene Organisationen, die künftig verstärkt auf das freiwillige Engagement ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer angewiesen sein werden, müssen Wege finden, ihren Freiwilligen gute Engagementerfahrungen möglich zu machen. Die Anerkennung sollte dabei nicht als Belastung empfunden werden, muss aber das Engagement der Freiwilligen verstetigen helfen. Die Frage, die sich hierzu stellt, ist freilich, welche Aspekte von Anerkennung eigentlich zur Belastung werden und welche anspornend wirken. Bisher lässt sich nur vermuten, dass die ‚beste‘ Form der Anerkennung darin besteht, den Freiwilligen die Wirkung ihres Tuns vor Augen zu führen; meint auch, ihnen ehrliche Rückmeldung zu ihrer Arbeit zu geben.
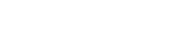
frisch gebloggt: "Anerkennung — vom 'Lohn für das freiwillige Engagement'" http://t.co/P7RJGdTO #Anerkennung #Freiwilligenmanagement
RT @foulder "Anerkennung — vom 'Lohn für das freiwillige Engagement'" http://t.co/MZYeH6cJ #Anerkennung #Freiwilligenmanagement
RT @foulder "Anerkennung — vom 'Lohn für das freiwillige Engagement'" http://t.co/MZYeH6cJ #Anerkennung #Freiwilligenmanagement
RT @foulder "Anerkennung — vom 'Lohn für das freiwillige Engagement'" http://t.co/MZYeH6cJ #Anerkennung #Freiwilligenmanagement
Unbedingt lesen! RT@foulder:"Anerkennung–vom'Lohn für das freiwillige Engagement'"http://ow.ly/1EtTzD #Anerkennung #Freiwilligenmanagement
@Dr_Frank_Weller "unbedingt lesen" Hui! Danke dir für die Blumen 🙂 http://t.co/P7RJGdTO #Anerkennung
Hallo Hannes,
Du hast die Problematik auf den Punkt gebracht!
Hier noch ein aktuelles Zitat von unserem Landrat, Wolfgang Schuster (SPD). Laut “Wetzlarer Neue Zeitung” vom 21.01.2012 hat er auf einem Neujahrsempfang der SPD gesagt:
“Das Ehrenamt wird künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen, da wir diese Leistungen nicht zahlen können”, so Schuster. Im Kreis würden jährlich 23 Millionen Stunden ehrenamtlich geleistet, das entspreche rund 200 Millionen Euro. Man dürfe das Ehrenamt nicht mit Sparzwängen überhäufen, sagte Schuster und plädierte für eine kostenlose Überlassung von Übungsräumen.
Übersetzung: Freiwilligentätigkeiten sind als unentgeltliche Dienstleistungen überaus wichtig. Der Kreis spart auf diese Weise Millionen ein, muss aber aufpassen, dass er die Ehrenamtler bei der Stange hält. Deshalb sollte er die Leute nicht durch überzogene Sparmaßnahmen im ehrenamtlichen Bereich verärgern. Dies wäre aus Sicht des Kreises unwirtschaftlich.
Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,
die kompensatorische Wikung freiwilligen Engagements ist ja nicht in Abrede zu stellen, das Argument, ‘wir könnten uns nie leisten das zu bezahlen’, grundsätzlich nicht falsch, doch ist das eben nicht die einzige Wirkung freiwilligen Engagements, das man den Engagierten vor Augen führen könnte, um sie ‘stressfrei’ anzuerkennen. M.E. ist die kostenlose Überlassung der Räumlichkeiten, die Wolfgang Schuster da forderte ein Teil der Ermöglichungsstruktur, die freiwilliges Engagement braucht. Selbstverständlich sollten ehrenamtlich getragene Initiativen die lokale Infrastruktur nutzen können. Schwierig wird’s aber, wenn die Räume als Sachleistung auch privaten Zwecken überlassen werden. Dann wird das Ehrenamt einmal mehr zum Tauschgeschäft.
In der Tat ist die Aussage des Landrats richtig. Allerdings sind Freiwillige zu Recht sehr verärgert, wenn sie das Gefühl haben, von Institutionen, Verwaltungen etc. als “billige Arbeitskräfte” angesehen zu werden. Zum Glück sind sie nach ihrem Selbstverständnis aber nicht für diese Stellen, sondern für andere Menschen tätig. Daher vergessen sie den Ärger und machen weiter. Jedoch sollten Politiker – wie Du richtig feststellst – sich um bessere Formen der Anerkennung bemühen und nicht allein den Kostenaspekt in den Raum stellen. Aber schau´n wir mal, demnächst ist Landratswahl und da bietet sich im Wahlkampf sicher die Möglichkeit, Fragen zur Anerkennung des freiwilligen Engagements zu stellen und zu diskutieren.
Ich frage mich ernstlich, ob Politik das Ehrenamt überhaupt anerkennen kann? Ich glaube das nicht. Anerkennung braucht nicht nur die reine Verwandlung eines semiotischen Reizes (sehen, hören, riechen, schmecken, tasten) in ein kulturspezifisches Modell der Umwelt (Ehrenamt erkennen) sondern auch das Kennen — meint den persönlichen Kontakt. Politik ist m.E. dafür Verantwortlich engagementförderliche Strukuren zu schaffen, nicht dafür Ehrenamt anzuerkennen. Das bringt eh nix.
Hm, interessante These, kann gut sein, dass das stimmt. Anerkennung bedeutet weit mehr als nur Lob auszusprechen. Einige interessante Hinweise finden sich hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Anerkennung . Hätte auch was für sich, wenn man an die Politik diesbezüglich keine großen Erwartungen hätte.
… Ich denke, ich werde zum Thema Anerkennung noch mal was schreiben. Vorher will ich mich aber ein bisschen mehr in Axel Honneths “Kampf um Anerkennung” einlesen.
Ui, das Buch kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ist eines meiner Lieblingsbücher 🙂
Hallo Hannes,
vielen Dank für diesen wirklich gelungenen Artikel.
Den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß von Anerkennung und dem Erleben von Verpflichtung finde ich sehr aufschlussreich. Darüber habe ich bis dato noch gar nicht nachgedacht.
Zu „Was tun?“: Im Grunde stehen die Antworten ja schon in deinem Text. Du schreibst, Ehrenamtliche erfahren Anerkennung über 1. die Vielfalt herausfordernder und bedeutsamer Tätigkeiten, 2. die Rückmeldung aus der Tätigkeit selbst, 3. die Anerkennung seitens der Empfänger von Hilfeleistung.
Der „Sinn der Tätigkeit“ und das „Erleben dieses Sinns“ sind meiner Meinung nach die Schlüsselpunkte bei der Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit. Es geht also, wie du ja auch feststellst, nicht darum eine sinnlose/langweilige/unpassende Tätigkeit auszuführen und durch irgendwelche anderen Anreize zu versüßen. Sondern darum, dass die Tätigkeit selber das ist, was die Tätigkeit versüßt.
Anerkennung zeigt sich m. E. in der Praxis entsprechend dort, wo Organisationen Tätigkeiten anbieten, die zu den individuellen Bedürfnissen der Ehrenamtlichen passen und diese größtmöglich berücksichtigen.
Dazu ist es wiederum wichtig a) den Ehrenamtlichen mitsamt seinen Vorlieben/Bedürfnissen kennen zu lernen, b) regelmäßig Feedback einzuholen, ob die Tätigkeit den Bedürfnissen noch entspricht oder evtl. verändert/angepasst werden muss, c) dem Ehrenamtlichen Feedback über die Wirkung seines Tuns zu geben (gerade dort, wo diese nicht unmittelbar sichtbar ist), d) überhaupt bereit sein, Ehrenamtliche als gleichwertigen Teil der Organisation zu akzeptieren und auf Augenhöhe zu interagieren.
Diese permanente „Rückmeldungsschleife“, die in der Interaktion entsteht, ist wesentlich für gegenseitige Anerkennung. Sie ist aber natürlich auch anstrengend und zeitaufwändig und wird deshalb (leider!) gerne vernachlässigt.
Grundsätzlich lässt sich diese Anerkennung aber nicht aufs Ehrenamt beschränken. Der „Sinn in der Tätigkeit“ wird auch unter Hauptamtlichen immer wichtiger. Gerade jüngere Generationen erleben ihren Beruf zunehmend nicht mehr nur als Verpflichtung, sondern ebenso als Möglichkeit der Selbstverwirklichung und Sinnstiftung. Wo Organisationen jetzt Schwierigkeiten haben, Ehrenamtlichkeit als sinnstiftenden Teil der Organisation zu inkludieren, werden sie m. M. nach noch mehr Schwierigkeiten haben, wenn es (künftig) darum geht, hauptamtlichen Fachkräften sinnstiftende Tätigkeiten anzubieten, die Fachkräfte zu gewinnen und zu auch halten.
Viele Grüße, Julia
Hallo Julia,
vielen Dank für deinen ausführlichen Kommentar. Ich habe das Büchlein Axel Honneths am Wochenende endlich bekommen und auch gleich reingelesen. Es scheint mir wirklich aufschlussreich zu sein. Zwei erste Erkenntnisse lassen sich auf jeden Fall schon formulieren:
(1) Thomas Hobbes’ Kampf aller gegen alle wurde bereits durch den frühen Hegel von seiner negativen Konnotierung befreit und als Medium der Verständigung konzipiert. Das macht es einfacher, den Kampf zunächst als notwendig anzusehen und stellt hauptamtliche vor die Entscheidung, welcher Seite sie sich anschließen wollen.
(2) Auch von Hegel stammt die Erkenntnis, jedes Individuum schaut “sich in jemandem als sich selbst an”, was für Honneth “Soldidarität” bedeutet für mich allerdings zunächst nur ein unzulässiger Schluss von mir (dem speziellen) auf das Allgemeine (das Gegenüber) darstellt.
Und eben hier ist das Problem: Wenn wir uns selbst in unserem Gegenüber zu erkennen glauben ist der Konflikt zwischen Haupt- und Ehernamt in eben diesem Sich-Selbst-Erkennen angelegt. Wenn es richtig ist — und davon gehe ich mal aus — dass die Nähe des Ehrenamtes zum Hauptamt der Motivation engegen steht (dazu Mösken/Dick/Wehner 2009) und das Ehernamt vom Hauptamt gestaltet wird (was aus strukturellen Gründen sinnvoll scheint), dann wird das Ehrenamt mindestens ein Stückweit immer auch als eine Art Hauptamt angelegt. Damit läuft auch deine — sehr sinnvolle — Feedbackschleife guten Freiwilligenmanagements ins Leere. Wir sprechen hier schließlich von subliminal ablaufenden psycho-sozialen Prozessen, die nicht einfach zu überwinden sein sollten.
Mal sehen was die weitere Lektüre so bringt … 🙂
Naja, “sich-selbst-im-anderen-erkennen” beschreibt ja zunächst einmal “nur” eine grundlegende, existenzsichernde Angewiesenheit des Menschen auf andere Menschen. Der Einzelne kann sich nur seiner Selbst gewahr werden, wenn andere Menschen mit ihm interagieren und er über diese Reaktionen der anderen, sein eigenes Verhalten (bzw. die Wirkung auf andere) interpretieren lernt.
Bezüglich der Anerkennung bedeutet das: Ich vollziehe eine Handlung, ein anderer reagiert darauf (mit Anerkennung oder Missachtung), vermittelt mir über seine Reaktion, wieviel Wert meine Handlung für ihn hat, was ich wiederum individuell interpretiere, in mein eigenes Selbstbild aufnehme, entsprechend selber eine Reaktion zeige, die der andere wiederum interpretiert usw.
Der “Clou” von Anerkennungsbeziehungen ist ja gerade, dass sie nicht ins Leere laufen, sondern dass sie ganz bewusst kein Ende besitzen und immer wieder neu verhandelt (erkämpft) werden müssen. (Das veranschaulicht z.B. auch sehr gut Gadamers Perspektive vom hermeneutischen Zirkel).
Natürlich werden Hauptamtliche immer auch ihre hauptamtliche Perspektive in den Freiwilligenbereich hineinlegen. Schließlich ist es unmöglich, sich von sich selbst zu lösen. Über die Interaktion mit den Ehrenamtlichen und dem Gewahrwerden der eigenen Wirkung, kann diese Perspektive jedoch verändert (ausgehandelt) werden. Umso wichtiger, denke ich, ist es, die Feedbackschleife gerade nicht zu vernachlässigen.
Aber natürlich hast du Recht, das ist ein schwieriger, sehr sensibler Prozess…
mh … das klingt schlüssig … damit ist der Kampf aber unvermeitlich. Und auch die Seite nicht ‘wählbar’. Wenn der Kampf das Medium der Aushandlung ist, ist er zwischen Haupt- und Ehrenamt generell angelegt. Damit muss es zunächst darum gehen, ihn mit möglichst wenigen Blessuren auszutragen — z.B. mit fomellen Gesprächen und Vereinbarungen, die im Weiteren durch formelles Feedback angepasst werden.
Ja, das “Überstehen des Kampfes” mit möglichst wenig “Blessuren” ist eine anschauliche Formulierung 🙂
Um Aushandlungsprozesse möglichst “glimpflich” auszutragen, ist es daher wichtig, die Interaktions-Bereiche einer Organisation zu identifizieren, die für wechselseitige Anerkennung eine Art Schlüsselrolle einnehmen (z.B. Feedback-Gespräche, Personalentwicklung, Führung) und auf anerkennungsfördernde oder -hemmende Handlungsoptionen zu untersuchen.
Das Treffen von formellen Vereinbarungen etc. könnte sich u. U. als fördernd erweisen.
Diese Vereinbarungen bedürfen dann aber auch (genau genommen) im Laufe der Zeit einer regelmäßigen Überprüfung und evtl. Neuverhandlung… 😉
Eine sehr spannende und wichtige Diskussion.
Allerdings glaube ich, dass – hauptamtlich oder ehrenamtlich, in klassische Vereinsstrukturen eingebunden oder im Bereich des sog. neuen zivilgesellschaftlichen Engagements – jeder Mensch nach Anerkennung strebt.
Was er/sie als Anerkennung empfindet, hängt in starkem Maße von den individuellen Motivatoren ab und ist damit aus meiner Sicht nicht standardisierbar, verhandelbar oder nach “Schema F” abzuarbeiten.
Wichtig scheint mir eher, die Befriedigung des Einzelnen aus der Sache und dem eigenen Tun heraus, ergänzt um eine Anerkennungskultur, die versucht, den individuellen Motivatoren Rechnung zu tragen … und daher auch ganz individuell ist.
Denn Anerkennung als Selbstzweck, aus Kalkül oder als Formalie verfehlt die gewünschte Wirkung.
Bleibt der Einwurf von Dr. Weller zur offensichtlichen Sichtweise der Politik auf’s Ehrenamt, das aus dem zitierten Blickwinkel zur kostenlosen Dienstleistung verkommt.
Mir scheint, hier hat die Politik sich – wie so oft – von der vielzitierten Basis entfernt und den Wandel auch in Engagementstrukturen noch gar nicht realisiert.
Auch im Sinne einer Anerkennungskultur wäre Politik besser beraten, die Frage aufleben zu lassen “In welcher Gesellschaft willst Du leben”, um so an die Verantwortung jedes Einzelnen für das Bild unserer Gesellschaft zu erinnern.
Dann die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Einzelne auch Verantwortung übernehmen können, wäre schon ein großer Schritt auf dem Weg zur Anerkennung / Wertschätzung.
Hallo Karin, vielen Dank für deinen Kommentar. Leider ist er mir kurz weggerutscht, deshalb antworte ich so spät …
Selbstverstänlich — ich neige dazu “natürlich” zu sagen — strebt jedermensch nach Anerkennung. Anerkennung aber vor allem seiner ganzen Person mit all seinen individuellen Bedürfnissen. Dazu gehört freilich auch das Hauptamt. Allerdings ist das Ehrenamt — und das zeigen die Studien der Arbeitspsychologen von der ETH-Zürich sehr gut — nicht mit dem Hauptamt zu vergleichen. Es geht also darum das Ehrenamt als Ehrenamt und nicht als eine Art Hauptamt (als Tauschgeschäft) anzuerkennen.
Bereits in meiner Diplomarbeit (das ist jetzt schon wieder drei Jahre her) schrieb ich in Anschluss an Mihaly Csikszentmihaliyi vom größten Motivator im freiwilligen Engagement: der Autotelik — dem Tun um des Tuns willen — bzw. dem Flow-Erleben — was laut Csikszentmihaliyi mit “Glück” gleichzusetzen ist. Insofern hast du Recht, wenn du schreibst, dass “die Befriedigung des Einzelnen aus der Sache und dem eigenen Tun” resultiert. Das muss aber nicht durch eine Anerkennungskultur “ergänzt” sondern vielmehr ermöglicht werden. Der Flow ist nämlich mitnichten ein Normal- oder Standardzustand. Menschen erleben ihn auf ganz unterschiedliche Weise und in ganz unterschiedlichen Situationen — ich z.B. recht häufig beim ‘Zusammenfummeln’ von HTML-Code für diesen Blog; eine Angelegenheit, die andere vielleicht zur Schnappatmung bringt (stresst).
Damit wird Anerkennung aber grundsätzlich Verhandlungssache und Gegenstand eines Kampfes den Haupt- und Ehrenamtliche ständig austragen müssen …
Jetzt muss ich die Diskussion doch noch einmal aufgreifen: Auf der Ebene der handelnden Personen stellt sich die Frage: Was bedeutet verhandeln konkret? “Echte” Verhandlungen setzten ja voraus, dass die Verhandlungspartner sich “auf Augenhöhe” begegnen. Also müssen Ehrenamtliche und Freiwillige für die Verhandlungen gestärkt und geschult werden, wenn sie Verhandlungspartner und – ganz wichtig – keine Bittsteller sein sollen. Sonst sind sie gegenüber Hauptamtlichen und der Politik immer im Nachteil. Hier müsste man ansetzen, wenn man ein ständiges Verhandeln oder Kämpfen um Anerkennung sieht.
.. ich glaube, die Verhandlungsmetapher leitet uns hier irr — treffender finde ich die des ‘Kampfes’ im Sinne einer Art und Weise sich zu verständigen, bei der die jeweiligs egoistischen Interessen einander gegenüber stehen.
Mir geht es um die Frage: Inwieweit ist das, was wir hier diskutieren, für die Praxis verwendbar? Daher halte ich den Begriff “Verhandlung” nicht für falsch. Denn in der Praxis wird tatsächlich oft um Ressourcen verhandelt: Wer bekommt welchen Raum? Ehrenamtliche oder Hauptamtliche? Wie wird dieser technisch ausgestattet? etc. Wie kommen Freiwillige hier auf “Augenhöhe”? Z.B., indem sie von einem starken Verein oder Verband, dessen Öffentlichkeitsarbeit die Hauptamtlichen oder die Politik fürchten, unterstützt werden. Wer hier keine Verhandlungsmacht hat – wie etwa einzelne Freiwillige -, wird nicht als gleichwertiger Partner angesehen und kann erst recht keinen Kampf gewinnen.
Mag sein, dass ich als als Jurist hier ein anderes Bild von Verhandlungen habe, aber der Begriff “Kampf” ist mir zu martialisch und würde m.E. auch von der Praxis leicht falsch verstanden. Vielleicht wäre “Auseinandersetzung” oder “Konkurrenz” ein Kompromiss.
In der wissenschaftlichen Diskussion ist vielleicht ein anderer Sprachgebrauch sinnvoll.
Hallo,
ich finde den Verhandlungsbegriff ganz passend. Vielleicht ist es sinnvoll, den Prozess in verschiedene Schritte aufzuteilen:
a) Vermittlungs-Prozess (d.h. Hauptamtliche und Ehrenamtlich vermitteln sich gegenseitig ihre Perspektiven, Bedürfnisse etc.);
b) Verstehens-Prozess (d.h. Haupt- und Ehrenamtliche versuchen die vermittelten Motive, Bedürfnisse, Bedarfe etc. des anderen zu verstehen);
c) Aushandlungsprozess (d.h. Haupt- und Ehrenamtliche versuchen zu verhandeln und ihre Bedürfnisse – angesichts knapper Ressourcen – in Einklang zu bringen)
d) die “Kampf”-Vokabel kommt m. E. dann zum Einsatz, wenn die ersteren Prozesse des Vermittelns, Verstehens und Verhandelns kein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis bringen oder gar nicht erst durchlaufen werden (z.B. weil Konkurrenz zu groß, kein Verständnis füreinander etc.).
Aus jedem Schritt lassen sich letztlich Kompetenzen, Maßnahmen etc. für die Praxis ableiten. Wobei ich es wichtig finde, nicht nur die eine Seite zu stärken, sondern Haupt- und Ehrenamt gleichermaßen auf die Interaktion vorzubereiten.
Gruß, Julia
Eine spannende Diskussion um die #Anerkennung im freiwilligen Engagement geht weiter: http://t.co/P7RJGdTO #Freiwilligenarbeit
Eine spannende Diskussion um die #Anerkennung im freiwilligen Engagement geht weiter: http://t.co/P7RJGdTO #Freiwilligenarbeit
Eine spannende Diskussion um die #Anerkennung im freiwilligen Engagement geht weiter: http://t.co/P7RJGdTO #Freiwilligenarbeit
Eine spannende Diskussion um die #Anerkennung im freiwilligen Engagement geht weiter: http://t.co/P7RJGdTO #Freiwilligenarbeit
Hallo Julia, hallo Frank, ich habe es heute mal ausprobiert: Die “Kampf-Vokabel” (mit dem Hinweis auf die Sozialphilosophie Axel Honneths) hat in meinem Vortrag beim DRK-Brandenburg schon gezogen. Meine Aussage war hier, dass man auch den ‘neuen Ehrenamtlichen’ den Kampf um Anerkennung nicht ersparen kann, man kann aber mit ihnen kollaborieren und schwere Blessuren (in Gestalt zu hoher Friktionsverluste) verhindern — z.B. in dem man alle anderen, die ja anerkennen müssen/sollen, auf die Arbeit mit den neuen Ehrenamtlichen vorbereitet.
In die weitere Tiefe betrachtet, finde ich aber deinen Vorschlag, Julia, sehr gut. im Freiwilligenmanagement geht ja um Vermittlung und Aushandlung — soziale Prozesse aber, die mit dem Kampf (im neutralen Sinne Honneths) allerdings recht gut auf den Punkt zu bringen sind. Überspitzen darf man es freilich auch nicht! Sonst wird der martialische Kampf (das übliche Bild des Wolfes, der dem Menschen ein Wolf ist) zu wörtlich genommen.
Der Vorschlag von Julia Russau bzw. der von ihr dargelegte Prozess ist m. E. für die Praxis gut verwendbar. Man kann dann den Begriff “Kampf” je nach Situation oder Zuhörerschaft erläutern oder ausweichen auf eine Vokabel wie “Auseinandersetzung”, wenn Missverständnisse drohen. Aber grundsätzlich kann man mit dem Vorschlag gut arbeiten.
‘gefällt mir’ 🙂
Eine spannende Diskussion zur Anerkennung – dem "Lohn" für die #Freiwilligenarbeit – geht weiter: http://t.co/KAdW3X3V
Eine spannende Diskussion zur Anerkennung – dem "Lohn" für die #Freiwilligenarbeit – geht weiter: http://t.co/KAdW3X3V
RT @foulder: Die Diskussion zur Anerkennung – dem "Lohn" für die #Freiwilligenarbeit – geht weiter > http://t.co/XfmkJ031
Ich finde es ganz toll, dass hier zum Thema “Anerkennung” auf teilweise wissenschaftlichem Niveau diskutiert wird. Als Mann der Praxis möchte ich einfach meine persönlichen Gedanken einbringen, ohne den Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu stellen.
Wenn von “Auswirkungen der ‚Entlohnung‘ freiwilligen Engagements” auch die Anerkennungskultur gemeint ist, dann stellt sich für mich die Frage “Warum engagiert” sich jemand. Daraus ließe sich auch schließen, was er* als Anerkennung oder Entlohnung (eventuell sogar in zählbarer Münze) erwartet.
Zählt man zum freiwilligen Engagement auch den ganzen Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) (siehe hierzu Wikipedia Bürgerschaftliches Engagement) und erweitert man das freiwillige Engagement auch auf Zivilengagement (ZE) (siehe hierzu Bericht des BMFSFJ – leider schon aus 2009) dann ergeben sich für mich einige Aspekte.
Freiwilliges Engagement z.B. bei Sportvereinen oder Wohlfahrtsverbänden erwartet zumindest Ersatz des direkten Aufwandes, wenn dann noch die Übungsleiterpauschale gewährt wird, dürfte die Erwartung fast vollständig erfüllt sein.
Etwas anders scheint es mir beim BE zu sein. Neben dem Ersatz des direkten Aufwandes dürfte auch die öffentliche Anerkennung bis hin zur “Ordensverleihung” zu betrachten sein. Je mehr das BE des Einzelnen auf den Nutzen der Kommune oder der Gemeinschaft ausgerichtet ist, dürfte auch der Wunsch nach Anerkennung durch Verleihung eines hohen staatlichen Ordens in der Erwartungshaltung liegen.
Beim ZE und hier meine ich nicht die Idealisten (Greenpeace u.ä.) dürfte noch dazu kommen, dass der Engagierte* es sehr schätzen würde in der Öffentlichkeit bekannt zu werden.
Zum Thema Anerkennung bzw. Erlangung von Aufmerksamkeit (auch eine Form der Anerkennung) möchte ich auf einen Bericht von Markus Brandl (Uni Köln) verweisen.
Unter der Überschrift Das ist so genial. Bitte nehmt euch kurz Zeit um dies zu lesen. beschreibt er eine sehr interessante Geschichte. Wirklich lesenswert. Schlussfolgerungen muss jeder für sich machen.
* hier wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit die maskuline Form gewählt, es ist aber immer auch gleichbedeutend die feminine Form der Anrede gemeint.
[…] Betonung der Sinnstiftung plädiert. Auch Hannes Jähnert verweist in seinem Artikel über den Lohn für das freiwillige Engagement auf die überwiegend intrinsische Motivation, die dem Ehrenamt innewohnt. Nach Jähnert sind es […]
RT @foulder: Anerkennung — vom Lohn für das freiwillige Engagement http://t.co/A2m5NZlq
RT @foulder: Anerkennung — vom Lohn für das freiwillige Engagement http://t.co/lXBqwnlq
RT @foulder: Anerkennung — vom Lohn für das freiwillige Engagement http://t.co/A2m5NZlq
[…] “als Lohn für das freiwillige Engagement“ meint in der Praxis vieler Nonprofits eine Art Tauschgeschäft: Arbeit gegen Bonbons. Hier […]
[…] hier im Blog festgestellt, dass es in deutschen NPOs am modernen Freiwilligenmanagement hapert, das Freiwillige nicht selten als kostenlose Dienstleister missverstanden werden, die mit Goodies gelockt und bei der Stange gehalten werden, das sich viele Haupt- und […]