Es ist Ostern: Die vierte Woche im Ausnahmezustand ist vorüber und ich frage mich, ob ›Ausnahmezustand‹ überhaupt noch das richtige Wort ist. Trotz des bestehenden Risikos einer zweiten Infektionswelle wird lautstark um die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen gerungen. Die Verluste der Wirtschaft gehen längst in die Milliarden und das Personal im Gesundheitssystem über die Belastungsgrenzen hinaus. Wie lange kann das eine Gesellschaft aushalten, die seit Jahrzehnten ›auf Kante genäht wird‹?
Der Bundespräsident bittet in seiner Ansprache um Geduld und Vertrauen. Doch die öffentlichen Debatten um die Heinsberg-Studie der Universität Bonn (PDF) und die Tracking-App des Robert Koch Instituts machen mir das nicht gerade leicht. Es sei Aufgabe der Wissenschaft, belastbare Fakten zu liefern, so Christian Drosten, Chef-Virologe der Charité in Berlin. Fakten, die eine stabile Grundlage für politische Entscheidungen liefern können.
Üblicher Weise wird in der Wissenschaft – auf Kongressen und in Publikationen – intensiv darum gerungen, was belastbar ist und was nicht. Es dauert oft Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis man sich so auf Grundlagen für Grundlagen einigt, die dann auch nur eine gewisse Halbwertszeit haben. Wissenschaft eben!
Aktuell haben wir diese Zeit nicht. Und, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, haben wir auch nicht genügend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bereit und fähig sind, die dürftige Faktenlage verständlich zu erklären. Da wird in der Öffentlichkeit lieber mit mehreren Nachkommastellen eine Exaktheit suggeriert, die es so gar nicht geben kann, und von »neuartigen Algorithmen« schwadroniert, die aus einer groben Wetterkarte diffusen Unwohlseins bevölkerungsrepräsentative Aussagen zur Verbreitung des Corona-Virus herbeizaubern sollen.
Ich bin da skeptisch, möchte aber nicht falsch verstanden werden: Ich bin davon überzeugt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Wahrheit suchen. Und mir ist sonnenklar, dass sie dafür Daten und den Diskurs brauchen. Halbgare Studienergebnisse und Big-Data-Phantasien aber gehören meines Erachtens auf Poster bei wissenschaftlichen Kongressen mit entsprechendem Publikum. In die breite Öffentlichkeit gehören dieser Tage eher die langweiligen Fakten, die zumindest halbwegs gesichert sind.
Von Gräben und Scheren
Was den ›Ausnahmezustand‹ anbelangt glaube ich, macht diesen aus, dass die Gräben und Scheren in unserer Gesellschaft in Krisenzeiten deutlich sichtbar werden. Beispielhaft macht das der Blick auf die Geschlechterverhältnisse im aktuellen Mediengeschehen deutlich. Und auch die digitalen Gräben tun sich heftig und schmerzvoll auf.
Als ich letzten Sonntag über die Chancen des digitalen Ehrenamts für Geselligkeit auf Distanz und damit für mentale und psychische Gesundheit schrieb, war mir schon klar, dass davon bei weitem nicht alle profitieren können: Wenn die Ressourcen für (digitales) Engagement fehlen, wird die vergemeinschaftende Kraft gemeinsamer Themen wohl kaum wirken können. Und die aktuelle Digital-Bias hat auch noch eine andere Auswirkung: Lösungsansätze, die beispielsweise beim #WirVsVirus-Hackathon entwickelt wurden, fußen meist auf Technik, die schlicht nicht allen zur Verfügung steht.
Das Problem daran ist einerseits natürlich, dass wir besonders vulnerable Gruppen – Menschen ohne Obdach oder demenziell Erkrankte – so gar nicht erreichen und andererseits die gesellschaftliche Entwicklung auch nicht stehen bleibt. Mit einigem Enthusiasmus wird derzeit die Stunde der Digitalisierung gefeiert. Wenn aber die Potentiale digitaler Technik für neues Arbeiten, smartes Wohnen und selbstständiges Lernen jetzt so richtig entdeckt werden, heißt das auch, dass (still und leise nebenher) auch deren Potentiale für digitales Micromanagement und perfide Kontrollsysteme mitentdeckt werden. Da braucht man nicht viel Phantasie, um zu ahnen, wer davon profitiert und wer nicht.
Vom Engagement für das Gute
In seiner Ansprache sage Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird. Und: Wie sie sein wird, das liegt an uns. Zurück in den alten Trott des »Höher, Schneller, Weiter« oder in eine bessere Zukunft? Eine Zukunft, in der wir aus Krisen – die es immer wieder geben wird – gestärkt hervorgehen; eine Zukunft, die von Vertrauen, Respekt und Solidarität gekennzeichnet ist oder eine Zukunft, in der der »Kampf um Anerkennung« (Axel Honneth) erbarmungslos weitertobt.
Wie viele andere wünsche ich mir nur das Beste. Ich weiß aber auch, dass es nicht das eine oder das andere gibt, sondern dass die ›unordentliche‹ Gleichzeitigkeit (Entropie) sehr viel wahrscheinlicher ist. Insofern ist das Engagement für das Gute – was immer das auch sein mag – vielversprechend, wenn es mit dem Bild eines größeren Ganzen versehen wird; wenn es auf einer Sensibilität für die Vielfalt der Existenzweisen fußt und so mehr als die eigene kleine Lebensrealität in den Blick nimmt.
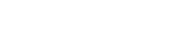
[…] ereignisreiche Wochen sind vergangen, seit ich über die Scheren und Gräben schrieb, die in der andauernden Corona-Krise offenkundig werden. Die Debatten über Lockerungen der […]