Julia Russau vom Blog Anerkennung-Sozial hat vorgestern einen lesenswerten Beitrag zur Ökonomisierung Sozialer Arbeit veröffentlicht. Ich habe den Beitrag erst heute Morgen gelesen, die thematische Überschneidung ihres mit dem hier folgenden Beitrag war also nicht beabsichtigt; wenngleich von Zufall wohl auch nicht zu sprechen ist …
Social Entrepreneurship – eine bequeme Lösung
Das Social Entrepreneurship wird hierzulande als eine mögliche – wenn nicht gar die – Lösung (zivil-) gesellschaftlicher Herausforderungen angesehen. Auf Seite fünf der Nationalen Engagementstrategie vom Oktober letzten Jahres ist demnach auch zu lesen, dass die Bundesregierung „diese Bewegung aufgreifen, die Innovationsfähigkeit des bürgerschaftlichen Engagements stärken und Möglichkeiten für die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch und im Engagement fördern“ will. Dabei werden die etablierten Verbände der Zivilgesellschaft auf die Rolle „wichtiger Partner der Bundesregierung im Bereich der Engagementpolitik“ reduziert und die Rolle von Bund, Ländern und Kommunen als „zentrale Akteure der Engagementförderung“ hervorgehoben. Im Klartext heißt das: Förderung selbsttragender Klein- und Kleinstunternehmungen mit zivilgesellschaftlichem Ambitionen bei gleichzeitiger Ressourcenverknappung für etablierte Organisationen der Zivilgesellschaft.
Der Nationalen Engagementstrategie ist hier eine Bequemlichkeit der Bundesregierung zu entnehmen, die – hier in Anlehnung an Heribert Prantels Kommentar in „Engagement macht Stark“ (08/2009: 16) – beim Wort „Zivilgesellschaft“ einen barmherzig-gütigen Gesichtsausdruck annimmt, der im seltenen Falle der Wahrnehmung relevanter Konflikte allerdings schnell wieder einfriert. Prantel sprach des Kontrastes halber an dieser Stelle vom globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC, an dessen Stelle aber auch zivilgesellschaftlich relevante Akteure aus der deutschen Wohlfahrtspflege oder dem (internationalen) Umweltschutz gesetzt werden könnten. Vor allem letzterer setzte die Bundesregierung in den vergangenen Monaten unter massiven Druck (Stichwort „Laufzeitverlängerungen“ und „Atomausstieg“). Für das politische System – dessen Machtakkumulation dem zivilgesellschaftlichen Einfluss skeptisch gegenüber stehen muss – sind irritierende Einmischungen von Umwelt- und Sozialverbänden schlichtweg lästig. Die Ochsentour durch die Parteigremien macht schließlich niemand, der oder die sich – oben angekommen – von zivilgesellschaftlichen Interessen herumschubsen lassen will.
Insofern ist also zu befürchten, dass die verstärkte Fokussierung auf sozialunternehmerische Ansätze auf lokaler Ebene – und nichts anderes meint “Entwicklung zukunftsweisender Lösungen durch und im Engagement” – den zivilgesellschaftlichen Einfluss auf Bundesebene beschränken wird. Für die deutsche Wohlfahrt lässt sich diese Befürchtung vereinfacht als Gebirge mit sechs hohen und vielen kleinen Bergen beschreiben, deren Spitzen – ragen sie zu hoch – peu á peu abgetragen werden.
Sozial- und Wohlfahrtsverbände in zivilgesellschaftlicher Verantwortung
Allein aus einer Perspektive, die den Staat als Finanzier zivilgesellschaftlier Organisationen in die alleinige Pflicht nimmt, würde aber verkannt, dass die Finanzierung und gesetzliche Grundlegung zivilgesellschaftlicher Organisationen allein wenig bewirken kann. Schließlich kann eine aktive Zivilgesellschaft nur befördert werden, wenn auch die entsprechenden Organisationen als Ermöglicher aktiv werden. Leider ist das vor allem in traditionellen Organisationen der Wohlfahrtspflege nur sehr bedingt der Fall. Nicht zuletzt wegen des weit verbreiteten Selbstverständnisses als Dienstleistungsbetrieb, wird freiwilliges Engagement hier häufig als (aus-) helfende Tätigkeit verstanden, für die zudem kaum Mittel freigemacht werden. Entgegen aller Rhetorik wird freiwilliges Engagement natürlich auch als kompensatorischer Faktor eingerechnet. Das jeweilige Leistungsspektrum muss schließlich erhalten und ggf. strategisch ausgebaut werden.
Nicht nur in der Nationalen Engagementstrategie fehlt es also an zivilgesellschaftlicher Perspektive, sondern auch in der deutschen Sozial- und Wohlfahrtspflege sind entsprechende Visionen rar gesät. Mit einer gesunden Ökonomisierung – meint: Investition in Innovation – und vor allem einem Schuss sozialunternehmerischem Denken, das nicht nur auf die Bewahrung bestehender Lösungen für gesamtgesellschaftliche Probleme ausgerichtet ist, sondern auch neue anstrebt und innovativ sein will, könnte hier durchaus Abhilfe geschaffen werden.
Damit ist die Förderung des Sozialunternehmertums in Deutschland also sehr ambivalent zu betrachten: Allein vermag es sicher nicht, die Zivilgesellschaft zu stärken. Ohne aber eine gewisse (sozial-) unternehmerische Grundhaltung, die gesellschaftliche Problemlagen zu Chancen für neue Entwicklungen umdeutet, versickert auch die umfassendste Förderung.
‚Ausbildung‘ von Social Entrepreneurs
Doch lässt sich eine sozialunternehmerische Denke im Dritten Sektor überhaupt etablieren? Wenn hier – wie auch im politischen System – von sich selbst reproduzierenden Strukturen ausgegangen werden muss, ist anzunehmen, dass auch die beste Idee und der noch so gute Wille im Laufe der Zeit unterminiert wird. Das also Pinguine auch aus einem noch so bunten Straußenvogel einen der ihren machen, wenn sie ihn (oder sie) nicht ewig im Abseits stehen lassen. Das Engagement sozialunternehmerisch denkender Change Agents kommt damit einem Kampf gegen Windmühlen gleich und Innovationen entstehen nicht wegen des Systems, sondern müssen ihm mühsam abgetrotzt werden. Keine rosigen Aussichten also für Menschen die mit den Mitteln des Sozialunternehmertums etwas verändern wollen.
Eine mögliche Lösung dieses Problems ist sicherlich, die Anzahl sozialunternehmerisch Denkender Menschen in Dritt-Sektor-Organisationen zu erhöhen – meint also eine kritische Masse zu schaffen, die nicht einfach ignorieren oder zu assimilieren ist und so bestehende Strukturen zu überwinden vermag. Das Problem:
Die versäulten Formen politischer, sozialer und kultureller Arbeit und die weitgehend eindimensionale auf Profitmaximierung orientierten Muster wirtschaftlichen Handelns hemmen gesellschaftliche Innovation. Diese Muster der Spezialisierung und fehlender Konnektivität finden sich in allen Strukturebenen unseres Bildungssystems. Insbesondere das niemals grundlegend reformierte Hochschulsystem bringt unter dem Begriff der Berufsfähigkeit immer mehr kennzahlgestählte Spezialisten auf dem Markt zukünftiger Führungskräfte (Gebel/Neusüß/Stark 2009: 22)
Soll also an der Anzahl der Change Agents in Sozial- und Wohlfahrtsverbänden gearbeitet werden, müssen zuallererst die Strukturen des Bildungssystems angegangen werden. Zwar reproduzieren sich die Strukturen hier ebenso selbst (Wagner 2010), doch gibt es mithin Lichtblicke guter Lehre, die durchaus sozialunternehmerisch denkenden Nachwuchs für den Dritten Sektor heranzuziehen vermag. Gebel, Neusüß und Stark stellen hierfür den Ansatz einer „Learning Journey“ vor, der die Hochschullehre „vom Kopf auf die Füße“ stellen soll.
Prinzipiell geht es bei diesem von der „Team Academy Finland“ inspirierten und an der Universität Duisburg-Essen entwickelten Ansatz darum, die einseitige Spezialisierung während des Hochschulstudiums zu überwinden und bei den Studierenden (sozial-) unternehmerische Haltung zu befördern. Dabei sollen die Studierenden lernen …
… eigene und fremde Ideen wertzuschätzen und ggf. zeitnahe zu erproben.
… interdisziplinär zu Arbeiten und das eigene Reflexionsvermögen dabei zu steigern.
… theoriegeleitet zu Handeln aber auch kritische Fragen aus der Praxis an die Theorie zu stellen.
An eben einer solchen „Learning Journey“ zum Social Entrepreneurship konnte ich im vergangenen Semester an der TU-Berlin teilnehmen. Als (relativ kleine) Gruppe von 13 Studierenden aus unterschiedlichsten Fachrichtungen und Semestern und in Begleitung unserer Dozentin Claudia Neusüß sowie sieben Pro-Bono-Coaches mit unterschiedlicher Praxiserfahrung, gingen wir auf eine Reise mit fünf Etappen:
- Potentialanalyse und Standortbestimmung: Hier ging es zunächst um das Kennenlernen in der Gruppe unter der Betonung der diversen Potentiale
- Seeing and Sensing: In dieser Phase der Feldanalyse wurden Herausforderungen und Handlungsfelder bestimmt und die Entwicklung eigener Projekte vorbereitet.
- Ideen- und Visionenentwicklung: Bei dieser Etappe beschäftigte uns vor allem die Frage, wie Innovationen in die Welt kommen und was wir dazu beitragen können. Ergebnis sollte hier ein SMARTes Projekt sein, das anschließend im Team bearbeitet werden sollte.
- Strategie und Projektentwicklung: In eben diesen Teams wurde ein Prototyp des erdachten Projektes entwickelt und wenn möglich auch gleich getestet.
- Schließlich folgten die gemeinsame Auswertung der gemachten Erfahrungen und die Präsentation der eigenen Projekte.
Auch wenn mir persönlich manch ‚alternative Lehrmethodik‘ á la „Teamreigen in rotem Tuch“ oder „Raumaneignung durch möglichst chaotische Umgestaltung der Inneneinrichtung“ sehr obskur vorkam, würde ich dem Konzept dieser Lernreise einiges an Potential beimessen. Es ist schon ein guter Ansatz Studierende so unterschiedlicher Fachrichtung wie Erziehungs- oder Bildungswissenschaft und Bautechnik in einer kreativen Atmosphäre zusammen zu bringen. Werden dann noch gemeinsame Grundlagen vermittelt, auf die sich aufbauen lässt (bei uns die „Theory U“ nach Otto Scharmer), können auch kleine Ideen ganz groß werden. Und selbst, wenn sie nicht „ganz groß“ wurden, selbst dann, wenn die gemeinsamen Ideen nur wie der zum 100sten Mal aufgewärmte Kaffee daherkommen und sich schließlich herausstellt, dass „Spaß haben und Geld verdienen“ hier nicht zusammen gehen, kommt dennoch brauchbares dabei heraus: Ersten hatten wir Spaß und waren bei der Sache (nicht alltäglich in der Universität), zweitens haben wir Erfahrungen im Team gemacht, die sich während des Studiums in diesem Ausmaß nur selten reflektieren lassen.
Zugegeben: Mir hing die ewige Reflektiererei bald aus dem Halse heraus und auf intensive (meint zeitfressende) Teamerfahrung hatte ich auch keinen großen Bock. Das mag daran liegen, dass ich schon eine ganze Weile an unterschiedlichen Hochschulen herumstudiere und entsprechend vorgeprägt bin. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mit sehr konkreten Vorstellungen zu einem möglichen Projekt in diesem Seminar aufgetaucht bin, für das anderen die Grundlagen fehlten. Oder daran, dass ich eben keine Lust auf aufgebrühten Kaffee hatte – also schon vor dem Aufbrühen meinte zu wissen, wie das Heißgetränk schließlich schmecken würde – doch begreife ich (jetzt) durchaus den Sinn dieses Unterfangens. Auch ein Lernerfolg!
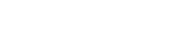
Frisch gebloggt: "#Sozialunternehmer für den Dritten Sektor — warum brauchen wir sie und wo sollen sie herkommen?" http://t.co/yM7sUyI
Frisch gebloggt: "#Sozialunternehmer für den Dritten Sektor — warum brauchen wir sie und wo sollen sie herkommen?" http://t.co/yM7sUyI
Jähnert: Sozialunternehmer!nnen für den Dritten Sektor. Warum & woher kommen sie? > http://ow.ly/6dmp1 | via @foulder #BEDialog #BEÖkonomie
Sozialunternehmer!nnen für den Dritten Sektor. Warum & woher kommen sie? > http://ow.ly/6dmp1 | Jähnert via @foulder #BEDialog #BEÖkonomie
Sozialunternehmer!nnen für den Dritten Sektor. Warum & woher kommen sie? > http://ow.ly/6dmp1 | Jähnert via @foulder #BEDialog #BEÖkonomie
RT @foulder: Sozialunternehmer!nnen für den Dritten Sektor – warum brauchen wir sie und wo sollen sie herkommen? http://t.co/LjUO9vj
Blog-Beitrag von Hannes Jähnert: "SozialunternehmerInnen für den Dritten Sektor. Warum & woher kommen sie?" http://t.co/6DguUH0
[…] früheren Tagen gewagt, sich mit der ansässigen Sozialstation zu vergleichen. Heute sind das alles Social Entrepreneurs, die (mehr oder weniger) professionell um die Gunst der Kundschaft werben. Wenn ich heute […]