Wie kommt einer zu einem freiwilligen Engagement? Im Idealfall liest er (oder sie) über eine Möglichkeit in der Zeitung oder hört etwas im Radio. Interessiert ihn die Sache, recherchiert er im Internet. Er findet andere Presseberichte und Plattformauftritte der Organisation und schaut auch auf deren Webseite vorbei. Dort findet er die Kontaktdaten für eine Ansprechpartnerin — eine mit dem Jobtitel “Freiwilligenmanagerin”. Er ruft sie an und bekommt hilfreiche Antworten auf seine offen gebliebenen Fragen. Die Freiwilligenmanagerin lädt ihn zum persönlichen Gespräch ein — ihr Anliegen: das richtige Engagement für den richtigen Freiwilligen.
Entscheidung #1 — das Erstgespräch
An diesem Punkt hat unser Interessierter das erste Mal eine Entscheidung zu treffen: Nimmt er die Einladung an oder nicht? Nimmt er sie an, ist das ein recht deutliches Signal: “Ich bin für ein Gespräch über ein freiwilliges Engagement grundsätzlich offen.” Nimmt er sie nicht an, ist das nicht ganz so deutlich: “Vielleicht bin ich für ein Gespräch offen, die Frau am Telefon fand ich aber unsympathisch.”
Zur Verfügung stehende Informationen
Auf welcher Grundlage könnte unser Interessierter nun diese Entscheidung treffen? Welche Informationen stehen bislang zur Verfügung?
- Er weiß, dass er sich bei der Organisation, von der er gelesen oder gehört hat, freiwillig engagieren kann (bestenfalls weiß er auch, was das bedeutet).
- Er hat ein subjektives Bild / einen Eindruck von der Organisation (z.B. hinsichtlich Professionalität, gesellschaftliche Wirkung oder Ansehen).
- Er hat einen subjektiven Eindruck von den Mitarbeitenden dieser Organisation, für die die Freiwilligenmanagerin stellvertretend steht.
Es ist relativ unwahrscheinlich, dass unser Interessierter die Einladung auf der Grundlage dieser Informationen ablehnt. Er hätte die Freiwilligenmanagerin sehr wahrscheinlich nicht angerufen, wenn er die Organisation und ihre Mitarbeitenden sowieso doof finden würde. Dem Radiobericht oder dem Zeitungsartikel hätte er wohl gar nicht erst seine Aufmerksamkeit geschenkt und ihn erst recht nicht im Internet nachrecherchiert. Warum? Weil er (wie die allermeisten Menschen) wenig Interesse daran hat, seine Vorurteile zu hinterfragen — schon gar nicht in seiner Freizeit.
Bauchgefühl und Vorurteile
In die Entscheidungsfindung unseres Interessierten spielen allerdings noch andere Faktoren hinein, die wenig mit den ihm vorliegenden Informationen zu tun haben — wohl aber mit seinen Vorurteilen über freiwilliges Engagement und Ehrenamt:
- Wird die frei zur Verfügung stehende Zeit an Feierabenden oder Wochenenden, ohne familiäre Verpflichtungen, als ausreichend eingeschätzt? Für wie lange lässt sich das überhaupt sagen?
- Gibt es im Freundes- und Bekanntenkreis Erfahrungen mit freiwilligem Engagement; vielleicht sogar mit der betreffenden Organisation? Gibt es Freunde oder auch das Gegenteil davon, die dort aktiv sind?
- Wie wahrscheinlich ist es, dass die individuellen Erwartungen an ein freiwilliges Engagement (z.B. Qualifikation, soz. Kontakte, Ansehen etc.) eingelöst werden?
Hier wird es schon wahrscheinlicher, dass unser Interessierter die Einladung der Freiwilligenmanagerin abgelehnt. Nicht etwa, weil tatsächlich etwas gegen eine Unterhaltung sprechen würde! Es sind die kalten Füße die einem Gespräch jetzt im Wege stehen. Gesetzt den Fall, die Freiwilligenmanagerin hätte unterschiedliche Engagements zu bieten, kann er vor dem Gespräch noch gar nicht wissen, ob seine freie Zeit für ein Engagement in der Organisation zu knapp ist oder nicht. Er kann auch nicht wissen, ob er mit dem guten Freunden oder dem unausstehlichen Nachbarsjungen, der vielleicht schon in der Organisation aktiv ist, etwas zu tun haben wird. Und er kann auch nicht wirklich wissen, inwieweit seine Erwartungen an ein freiwilliges Engagement eingelöst werden können, ohne fundierte Erfahrungen einzubeziehen.
Mit dem grundsätzlichen Interesse an einem freiwilligen Engagement und einem bestimmten Gefühl im Bauch steht unser Interessierter jetzt also vor der Entscheidung, die Einladung zum Gespräch wahrzunehmen oder nicht. Wäre er klug, würde er sich auf ein ergebnisoffenes Gespräch einlassen. Er könnte die entsprechende Fragen stellen und so mehr Informationen für seine Entscheidung für oder gegen ein Engagement bekommen. Wäre er es nicht, würde er sich in diesen Ausflüchten ergehen und die Einladung nicht wahrnehmen.
Entscheidung #2 — die Probezeit
Nehmen wir mal an, er wäre klug. Er würde zum Gespräch gehen und herausfinden, dass es unterschiedlich flexible Möglichkeiten des Engagements gibt, die mit seiner jetzigen Freizeitsituation gut vereinbar sind und in gewissen Zeitabständen überdacht und geändert werden können. Er findet auch heraus, dass die Organisation so groß ist und so viele Engagementangebote bereit hält, dass er mit dem unausstehlichen Nachbarsjungen nicht mehr zu tun bekommt als ihm vielleicht auf dem Sommerfest über den Weg zu laufen.
Nach dem Gespräch stünde er dann vor der Entscheidung, es mit dem freiwilligen Engagement zu versuchen oder nicht, wobei die Rede von der “Entscheidung” an dieser Stelle eigentlich paradox ist (Luhmann 2011: 124ff). Zwischen welchen Alternativen kann sich unser Interessierter logischer Weise noch entscheiden? Ist in Anbetracht der nicht unerheblichen Vorleistungen das Nicht-Engagement nun eigentlich noch eine erstzunehmende Option? Bestenfalls sind die Ursachen für die kalten Füße ausgeräumt und gemeinsam mit der — ebenfalls klugen — Freiwilligenmanagerin ein auch zeitlich passendes Engagement gefunden. Die letzte noch offene Frage ist, ob seine Erwartungen an das Engagement erfüllt werden können oder nicht. Die kann allerdings auch die Freiwilligenmanagerin nicht so recht beantworten. Deshalb vereinbaren sie eine Art Probezeit von drei Monaten. Mal sehen, ob es dann weiter geht oder nicht.
In dieser Probezeit sammelt unser neuer Engagierter weitere Informationen, die ihm als Grundlage dienen, eine Entscheidung für oder gegen die Fortführung bzw. Verstetigung des Engagements zu treffen:
- Macht das praktische Engagement Spaß (bringt es Freude, Erfüllung, Zeitvertreib etc.)?
- Lässt sich das Engagement tatsächlich mit dem (knappen) Freizeitbudget bedienen?
- Was sagen Freunde, Bekannte und Kollegen, was sagt die Familie zu dem freiwilligen Engagement?
- Passt die Zusammenarbeit mit den anderen haupt- und ehrenamtlich Engagierten zum eigenen Engagementstil?
- Gibt es in dem Engagement genügend Möglichkeiten, die eigenen Kompetenzen einzubringen und weiter zu entwickeln?
- …
In den ersten Monaten des Engagements sind die Eindrücke sehr vielfältig, weshalb sich die Liste nicht abschließen lässt. Die Eindrücke reichen von Begeisterung für die neuen Aufgaben über Neugier hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Auswirkung hin zu Zweifeln an der eigenen “Entscheidung” und führen nicht selten auch zu Frustration über nicht erfüllte Erwartungen. Führt unser Freiwilliger nicht akribisch Tagebuch — und wer tut das schon — wird er am Ende der Probezeit wieder vor einer Entscheidung stehen, die er aus dem Bauch heraus fällen muss: Engagement weiterführen oder nicht?
Entscheidung #3 — die Verstetigung
Sicherlich gibt es immer wieder Freiwillige, die nicht weitermachen oder zwischendurch kündigen. Dass unser neuer Engagierter kündigt, ist aber so wahrscheinlich nicht. Mit der Aufnahme seines Engagements ist er in ein neues Soziotop eingetaucht, in dem das Meiste zunächst neu, unvertraut und entsprechend spannend ist. Eine gewisse Begeisterung zu wecken, ist in dieser Phase, in der unser neuer Engagierte ja noch auf keine eigenen Erfahrungen zurückgreifen kann, nicht sonderlich schwer — (leere) Versprechungen, Hinhalte- und Beschäftigungstaktik klappen hier noch richtig gut 🙂
Anders wird das, wenn unser neuer Engagierter beginnt, sein eigenes Engagement zu reflektieren. “Was hat’s bislang gebracht?” (persönlich/gesellschaftlich) Diese Reflexion — wenn sie denn stattfindet — aber kommt lange nach der relativ kurzen Probezeit und damit auch nach der Entscheidung, das Engagement weiterzuführen oder nicht. Warum? Weil unser Engagierter dann schon in die organisationale Arbeitsteilung eingebunden ist und weiß, dass andere von seinem Engagement abhängig sind (“altruistische Geiselhaft”). Auch wenn er sich nicht so sicher ist, ob die Arbeit mit anderen Engagierten einen konkreten Nutzen für die Gesellschaft oder ihn selber hat, wird er sein Engagement vorerst aufrecht erhalten, weil er niemanden vorsätzlich in die Bredouille bringen will. So lange es geht wird er sich einreden, dass er etwas sinnvolles tut — auch wenn es vielleicht nicht so ist.
Soweit der worst case, der früher oder später im Abbruch des Engagements und der Beziehung zu der Organisation endet. Der best case ist natürlich, dass die von der Freiwilligenmanagerin angestoßene Reflexion zum gegenteiligen Ergebnis kommt: “Das Engagement ist sinnvoll und nützlich!” (persönlich/gesellschaftlich) Dann braucht sich niemand mehr etwas einzureden und die Motivation zum weiteren Engagement kommt wie von selbst.
Kritik der Entscheidung
Freiwilliges Engagement wird häufig als bewusste Entscheidung dargestellt. Interessierten, die die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, wird unterstellt, sie würden — wie unser Protagonist — Informationen einholen, sich ausführlich beraten lassen, um dann umfänglich vorbereitet ein Engagement aufzunehmen. Das ist m.E. auch ein Grund dafür, warum immer wieder gefragt wird, ob das externe Engagementpotential über die Bereitstellung von Informationen im Internet (“kost’ ja nix”) zu mobilisieren sei. Übersehen wird dabei, dass die Zahl derjenigen, die einem Engagement grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber stehen und sich aus diesem Grund selbstständig Informieren, recht überschaubar ist (für Jugendliche siehe Begemann et al. 2011: 6).
Der hier skizzierte idealtypische Verlauf zeigt, dass die “Entscheidung” für ein freiwilliges Engagement wenig mit der Abwägung gleichwertiger Alternativen zu tun hat und insofern gar keine richtige Entscheidung ist. Das gilt auch für andere Zugänge zum freiwilligen Engagement wie persönliche Freundschafts-Netzwerke (insb. im Sport) oder Gemeinschaften mit großer sozialer Kontrolle (insb. religiöse Communitys). Bei alle dem ist eher von der Entwicklung einer Beziehung zwischen Bürger und Nonprofit-Organisation auzugehen, die dazu führt, dass aus Interessierten Engagierte werden.
Einmal mehr also rückt Beziehungsaufbau und -pflege ins Zentrum des Freiwilligenmanagements. Vielleicht lassen sich Engagementinteressierte mit Versprechungen zum Return on Engagement (Spaß, Qualifikation, Wirkung usw.) ködern, längerfristig zum Engagement motivieren lassen sie sich damit aber nicht. Der Irrglaube, man hätte es bei Engagementinteressierten mit Entscheidern zu tun, die womöglich ähnlich funktionieren wie die Broker auf den Parketts in den Börsenmetropolen der Welt, führt zu leeren, allgemeinen Versprechungen, zu Überredungs- und Beschäftigungstaktik, die (a) eine gute Beziehung zwischen Freiwilligem und Nonprofit erschweren/verunmöglichen und (b) workplace-fixierte Managementmodelle hervorbringen, die das euphorische Kommen und frustrierte Gehen von Freiwilligen von vorn herein einkalkulieren und abzufedern suchen.
tl;dr: Je fortgeschrittener die Beziehung zwischen Bürger und Nonprofit, desto weniger lässt sich von einer echten Entscheidung für oder gegen ein freiwilliges Engagement sprechen.
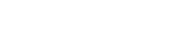
Du schreibst: “Bei alle dem ist eher von der Entwicklung einer Beziehung zwischen Bürger und Nonprofit-Organisation auzugehen, die dazu führt, dass aus Interessierten Engagierte werden” .
Eine andere These findet sich in einem wzb-Papier: hier spielt die Bildungshomogenität persönlicher sozialer Netzwerke die entscheidende Rolle, ob jemand ein Engagement aufnimmt oder nicht und nicht die Beziehung Büger-NPO. “Die vorliegenden Berechnungen zeigen (..), dass die Übernahme eines Engagements nicht nur von der eigenen Bildung, sondern offensichtlich auch von der Bildung der Netzwerkpartner abhängt” (Emmerich 2013, 4). Engagamentförderung sei somit fast nicht zu schaffen. Die Individuen können die Bildungshomogenität ihrer Netzwerke nur schwer aufbrechen und von außen könne man das kaum bis gar nicht.
Mehr dazu unter http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-zivilengagement/WZBriefZivilengagement092013_emmerich.pdf
Hallo Brigitte,
vielen Dank für den Hinweis auf den WZB Brief. Die Prognose Emmerichs ist ha ziemlich finster. Soweit ich weiß widerspricht sie auch anderen Befunden des gleichen Autors: nämlich, dass in Institutionen wie der Kirche ganz unterschiedliche Menschen zusammenfinden, die sich — bedingt durch soziale Kontrolle — auch ‘freiwillig’ engagieren. Das gleiche passiert im Sport!
Dch wie dem auch sei, ich werde mir den Brief von Emmerich noch einmal genauer anschauen.
Hannes