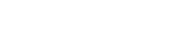In meinem letzten Beitrag zur “Zeit der Monster” habe ich mich mit der Krise der modernen Gesellschaft beschäftigt. Ich hatte mich dafür durch ein paar der Bücher von Andreas Reckwitz gewühlt, der mindestens den “apertistischen” – öffnenden – Liberalismus, wenn nicht sogar die moderne Gesellschaft selbst zu Ende gehen sieht. Für Reckwitz deutet viel darauf hin, dass als nächstes ein eher auf Regulierung ausgerichtetes politisches Paradigma folgt – er sieht einen einbettenden Liberalismus aufziehen, in dem etwa die Pflichtenethik Immanuel Kants ein Revival erleben könnte.
EINE SOZIALISTISCHE REPARATUR DER MODERNE?
Die Frage, was wohl als nächstes – nach der Zeit der Monster – kommen könnte, treibt mich seither viel um. Natürlich weiß niemand so genau, was die Zukunft bringt und auch kluge Beobachter:innen können sich irren. Mit Reckwitz’ Überlegungen zu einem einbettenden Liberalismus aber lässt sich ganz gut über Möglichkeiten einer Reparatur der Moderne nachdenken. Zumindest die Vorstellung, dass das Pendel von der Öffnung zurück zur Regulierung schlägt, erscheint mir nachvollziehbar. Gleichwohl Reckwitz das keineswegs als ausgemacht ansieht (ebd. 2019: 286), ziehen wir dann und wann ja doch unsere Schlüsse aus der Geschichte.
Was also hat es mit dem einbettenden Liberalismus auf sich? Wie gesagt: Im Gegensatz zum apertistischen Liberalismus soll es sich hier wieder um ein Regulierungsparadigma handeln, in dem aber die Planungs- und Steuerungsphantasien des sozial-korporatistischen Paradigmas nicht einfach wiederholt werden. Vielmehr geht es darum, die seit dem Ende 1970er Jahre aus dem Ruder gelaufenen Entwicklungen einzufangen: Laut Reckwitz (2019: 285f.) handelt sich es sich bei dieser neuen Version des Liberalismus im Kern um ein politisches Paradigma, das vor allem die Ordnungsbildung – statt die populistische Kanalisierung sozialer Kräfte oder gar die Imagination einer “Volksgemeinschaft” – ins Zentrum rückt; revitalisiert werden soll so das kulturelle und soziale Allgemeine, das in der “Gesellschaft der Singularitäten” (Andreas Reckwitz) in die Krise geraten ist; grundlegende Einsichten indes, etwa die, dass sich moderne Gesellschaften nur dynamisch stabilisieren können (Hartmut Rosa), werden dabei nicht negiert aber in neue Rahmenbedingungen (Ordnungen) eingebettet.
Wie das in der Zukunft konkret aussehen könnte, lässt Reckwitz weitgehend offen, skizziert allerdings ein paar Herausforderungen, die es auf dem weiteren Weg zu meistern gilt (ebd. 2019: 293-304):
- Die Überwindung des Meritokratismus hin zu einer Arbeitsteilung, die die Leistungen aller anerkennt und soziale Ungleichheiten abmildert.
- Die Auflösung der Stadt-Land- beziehungsweise Metropol- und Peripherie-Differenz durch bedarfsgerechte Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
- Die Grundversorgung öffentlicher Infrastruktur, deren Pflege und Ausbau im Sinne einer Versorgung mit elementaren Ressourcen für alle.
- Die Suche nach dazu passenden Grundregeln, etwa die einer authentisch gelebten Kultur der Reziprozität, der Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten.
Wie aber könnte sich das in der Zukunft gestalten? Wie könnten soziale Ungleichheiten abgemildert, gleichwertige Lebensverhältnisse gefördert und eine elementare Grundversorgung für alle sichergestellt werden? Ein paar – teilweise naheliegende – Antworten auf diese Fragen meine ich bei dem französischen Ökonomen Thomas Piketty gefunden zu haben.
Mit seinen Büchern “Das Kapital im 21. Jahrhundert” (2013) und “Kapital und Ideologie” (2019) hat Thomas Piketty in den letzten Jahren einiges zu den Debatten um soziale Ungleichheit und deren möglicher Überwindung beigetragen. In seinem jüngsten Buch “Eine kurze Geschichte der Gleichheit” (2021) fasst er die wesentlichen Argumente zusammen und erzählt dabei von den historischen Erfolgen, die moderne Gesellschaften bei der Herstellung von Gleichheit zwischen den 1950er und 1970er Jahren erzielt haben.
Resümierend tritt Piketty für einen „demokratischen und föderalen, dezentralisierten und partizipativen, ökologischen und multikulturellen Sozialismus“ ein (ebd. 2021: 256). Pikettys Variante des Sozialismus scheint mir ganz gut zu treffen, was Reckwitz als reflexive Reparatur der Moderne skizziert (ebd. 2021: 418ff.). Zur Erinnerung noch einmal meine Zusammenfassung Reckwitz’ Skizze zur “Reparatur der Moderne” vom letzten Mal:
Durch eine reflexive Transformation geht die moderne Gesellschaft die grundlegenden Probleme der Spätmoderne an und macht daraus eine Tugend: Die radikale Offenheit der Zukunft geht nicht mehr einher mit dem Glauben daran, dass am Ende alles gut wird; die Zukunft wird nicht allein mit Innovationen, sondern vor allem mit bereits Erreichtem gestaltet; und die kreative Zerstörung richtet sich nicht länger auf die verletzlichsten Teile der Gesellschaft und ihrer Umwelt, sondern auf dessen Angreifer.
EINE KURZE (!) GESCHICHTE DER GLEICHHEIT
Der Sozialismus Pikettys hat hierfür durchaus etwas zu bieten, denn er fußt eher auf empirischen Grundlagen als Phantasien von ‘unsichtbaren Händen’ – empirischen Grundlagen insbesondere zu Einkommens- und Vermögensverteilung und damit zusammenhängenden Machtverhältnissen. Piketty empfiehlt, den Kampf um die Gleichheit der Chancen „auf der Basis solider historischer Kenntnisse” (ebd.: 2021: 14) zu kämpfen, denn aus den Fortschritten seit Beginn der modernen Gesellschaft im 18. Jahrhundert und insbesondere aus denen im 20. Jahrhundert lässt sich viel lernen, was für ihn historische Datenreihen zu (Hoch-)Schulbildung, Lebenserwartung, Bevölkerungswachstum und Einkommen zeigen (vgl. Piketty 2021: 29-33).
Um es an Einkommensverteilung in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhundert konkret zu machen, lohnt ein Blick auf die World Inequality Database (wid.world): Filtert man die für Deutschland verfügbaren Datenreihen zum kumulierten Einkommen nach dem oberen Dezil (die 10% der Top-Verdiener:innen) und den unteren fünf Dezilen zeigt sich das folgende Bild:
- Bis etwa 1920 vereinte das oberste Dezil mit 49,7 Prozent beinahe dreimal so viel Einkommen auf sich wie die unteren fünf Dezile zusammen (17,2%).
- In den 1920er Jahren (Weimarer Republik, Weltwirtschaftskrise) änderte sich das: Die unteren 50 Prozent verzeichneten ein leichtes Plus (+5,1%), die Einkommen der oberen 10 Prozent brachen drastisch ein (-14,7%).
- Im Nationalsozialismus ab den 1930er Jahren spreizte sich die Einkommensverteilung erneut: Die oberen 10 Prozent legten ordentlich zu (+9,1%), die unteren 50 Prozent bekamen wieder weniger (-3,1%).
- In den „Wirtschaftswunderjahren“ der 1950er bis 1970er sanken die kumulierten Einkommen des oberen Dezils erneut, während die der unteren 50 Prozent moderat stiegen. Anfang der 1980er Jahre betrug die Differenz der beiden Schichten ‚nur‘ noch 2,3 Prozent.
- Seither nimmt die Einkommensungleichheit wieder zu: Anfang der 2020er Jahre sind wir erneut bei einer Differenz von 16,8 Prozent zwischen Ober- und Unterschicht angekommen – ähnlich wie Mitte der 1950er.
Die für Deutschland verfügbaren Daten zu den Vermögens- oder Besitzverhältnisse zeigen ebenso drastische Unterschiede: Während die unteren 5 Dezile heute zusammengenommen kaum 4 Prozent von allem besitzen, was es in Deutschland zu besitzen gibt, können die oberen 10 Prozent Anfang der 2020er Jahre weit mehr als die Hälfte aller Besitztümer ihr Eigen nennen. Und auch hier zeigt sich, dass „Die große Umverteilung, 1914 bis 1980“ (Piketty 2021: 136) deutlich zu Lasten der vermögenden Oberschicht stattfand: Seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 schmolzen die Vermögen des oberen Dezils von über 85 Prozent auf etwa 50 Prozent in den 1980er Jahren ab. Geht man davon aus, dass die unteren 50 Prozent in der Geschichte nie mehr als 10 Prozent des Vermögens auf sich vereinen konnten – die Datenreihen für Frankreich zeigen das –, liegt nahe, dass die Mittelschicht (die 40% zwischen den oberen 10 und den unteren 50%) in dieser Zeit deutlich zulegten – was in Frankreich auch so war (siehe Piketty 2021: 55).
Wichtig der Hinweis an dieser Stelle, dass weder die Verheerungen der beiden Weltkriege noch die Weltwirtschaftskriese allein das Abschmelzen großer Vermögen und (damit zum Teil verbunden) die Einkommenseinbußen der Oberschicht erklären. Die statistischen Talfahrten hielten dafür viel zu lange an. Piketty zeigt: Es war der durch progressive Steuern finanzierte Aufstieg des Sozialstaates. Die Bildungsexpansion, der Ausbau Sozialversicherungen und die Stärkung betrieblicher Mitbestimmung aber wären ohne das Engagement der Arbeiterbewegung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts kaum denkbar gewesen – ein kämpferisches Engagement, das Piketty empfiehlt wieder verstärkt aufzunehmen.
Es gibt menschlichen Fortschritt und der Weg zur Gleichheit ist ein Kampf, der gewonnen werden kann. Aber er ist auch ein Kampf mit ungewissem Ausgang, ein anfälliger sozialer und politischer Prozess, der nie abgeschlossen und gesichert ist (Piketty 2021: 29).
TAKE AWAYS FÜR DIE REPARATUR DER MODERNE
Was also lässt sich für eine reflexive Reparatur der Moderne mitnehmen? Brauchen wir wirklich einen neuen Sozialismus? Ich bin da skeptisch, glaube aber, dass sich ein paar der Vorschläge Thomas Pikettys zusammenfassen und mitnehmen lassen:
1. DATEN ALS BASIS
Zur Überwindung des Meritokratismus – eigentlich besser: der äußerst schief hängenden Vorstellung ‘verdienter Herrschaftsansprüche’ – scheint mir ein nüchterner Blick auf die Daten besser geeignet als der “Diskurs” über vermeintliche Leistungsgerechtigkeit. Allein die Daten zur Vermögensverteilung lassen mich zweifeln, ob sich da überhaupt von irgendeiner Leistung sprechen lässt – außer vielleicht der, möglichst steueroptimiert zu (ver-)erben. Und auch bei Themen wie Bildung und Geschlechtergerechtigkeit erscheinen mir Daten bessere Anhaltspunkte für echten Fortschritt zu bieten – zumindest dann, wenn ihre Erhebung wissenschaftlichen Standards genügt.
Den Diskurs, den Streit und die Debatten um die besten Lösungen wird man so nicht beenden, mit Daten als Basis ließe sich aber zumindest dem meritokratischen Reflex des Nach-Unten-Tretens entgegenwirken. Piketty schlägt zum Beispiel eine automatische Grundsicherung (er schreibt von “Grundeinkommen”; ebd. 2021: 176) vor, mit dem zweierlei sichergestellt wird: (1) dass niemand in Armut leben muss, wobei die Grenze zur Armut bei 60 Prozent des Einkommensmedians festgelegt wird, und (2) dass die Gewähr der Grundsicherung vom faktischen Einkommen abhängt und nicht von der Beurteilung durch Bürokrat:innen.
2. KAMPF ALS MODUS
Der Kampf um gleichwertige Lebensverhältnisse und faire Ressourcenverteilung “ist ein Kampf, der gewonnen werden kann” (Piketty 2021: 29). Er muss dafür aber auch geführt werden, denn allein werden sich die Auswüchse des apertistischen Liberalismus nicht zurückdrängen lassen. Pikettys “Weltformel” ist hierfür recht bezeichnend. Mit r > g fasst er eine zentrale Tendenz moderner Gesellschaften zusammen: Die Rendite aus Vermögen (r) wächst langfristig schneller als die Wirtschaft und die damit verbundenen Einkommen aus Arbeit (g). Der Youtuber Politify fasst das anschaulich zusammen.
Gesetzmäßigkeiten wie Pikettys r > g sind keine Naturgesetze! Die “kurze Geschichte der Gleichheit”, die von den 1950ern bis zum Ende der 1970er spielt, zeigt das. Mit Sicherheit waren die Vermögenden und Spitzenverdiener:innen seiner Zeit wenig begeistert von progressiven Steuern auf Einkommen, Vermögen und Erbschaft. Hätten sich die Arbeiterbewegungen nicht für den Aufbau des Sozialstaates stark gemacht, der aus eben jenen Steuern bezahlt wurde, hätte sich die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen den unteren 50 und den oberen 10 Prozent (s.o.) sehr bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder geöffnet.
3. GELD ALS HEBEL
Dass Geld – als Einkommen zum Beispiel – ein Anreiz für Leistung sein kann, ist schwer zu bestreiten. Seinen Unterhalt zu sichern, ist schließlich ein ganz wesentlicher Grund, um überhaupt einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Mehr Einkommen heißt aber nicht unbedingt mehr Leistung. Viele Variablen bestimmen, wie gut oder schlecht ein Job bezahlt wird. Wichtig sind da etwa der Umsatz, der natürlich von Absatzmöglichkeiten und erzielten Preisen abhängt. Wichtig ist aber auch die ‘menschliche Komponente’ – neben Umfang und Art des benötigten “Humankapitals” auch und insbesondere die Gier nach immer Mehr – mehr Einkommen, mehr Prestige, mehr Einfluss etc.
Anhand des Effekts der “Vorverteilung” (2021: 152f.) zeigt Piketty, dass eine progressive Steuer auch hierauf wirken kann. Zum Effekt der Umverteilung von ‘oben nach unten’ bewirkt die progressive Steuer nämlich auch, dass sich die Lebensstandards nicht exorbitant weit voneinander entfernen – dass die Gräben zwischen Herrschern und Beherrschten etwa nicht immer breiter werden und dass so noch beiderseitige Anteilnahme und Verständigung auf Regeln im Sinne der Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten möglich ist.
Quellen:
Piketty, Thomas (2021): Eine kurze Geschichte der Gleichheit. (zit. nach 2. Auflage 2024). München: C.H. Beck Paperback.
Reckwitz, Andreas (2019): Das Ende der Illusion. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. (zit. nach 7. Auflage 2020). Berlin: Suhrkamp.