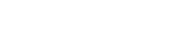Neulich war ich eingeladen, bei einem Workshop des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) über die „Bedeutung sozialer Innovationen in Nonprofit-Organisationen“ zu sprechen. Eine schöne Gelegenheit, die alten Grundlagen rauszukramen, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen und mit neuen Erkenntnissen aus aktuellen Projekten aufzufrischen. Der Talk im Workshop war eher ein Gespräch, das ich hier etwas strukturierter darstellen will: Vom allgemeinen Verständnis, dessen, worum es mir eigentlich geht, über den Prozess und die vielen Hürden auf dem Weg, bis zu jenen, die es tun sollten, und die Taktiken, die dafür nützlich sind. Am Ende gibt’s also auch ein paar praktische Beispiele.
Systemische Veränderung statt Nebelkerzen
Nach meiner Beobachtung reagieren Organisationen – insbesondere etablierte – auf veränderte Ansprüche und Anforderungen aus ihrer Umwelt mit dem Anbau von Zuständigkeiten. Im Grunde versuchen sie damit die Komplexität der Umwelt im Inneren abzubilden. Gleichzeitig reduzieren sie diese Komplexität durch die Bildung alter und neuer Silos auf ein für die Mitglieder erträgliches Maß. Diese können so ihre Aufgaben effizient erfüllen, arbeiten effektiv aber eher an einander vorbei.
Soweit es sich dabei um fachlich spezialisierte Arbeitsfelder handelt, ist das vielleicht nicht all zu schlimm. Die Arbeitsergebnisse lassen sich über die Ebenen transportieren und entsprechend verwerten. Bedenklich finde ich aber, dass das häufig auch das Schicksal von Querschnittsthemen ist, die eigentlich – davon bin ich zumindest überzeugt – auf ein verändertes Wie der Aggregation von Wissen und der Erbringung von Leistungen zielen sollten. Was nützt es denn, überspitzt formuliert, Querschnittsthemen wie Diversity oder Digitalisierung zu bearbeiten, wenn der Kollege im Nachbarbüro auf seiner Schreibmaschine das Gendersternchen nicht findet?
Machen wir uns nichts vor: Auch die Innovationsförderung kann ein solches Schicksal ereilen. Wenn sie sich bei ihren Projekten vor denen versteckt, die nicht zur Allianz der Willigen gehören, wird sie sich vielleicht mit allerhand Leuchtturmprojekten gegenüber Fördermittelgebern selbst legitimieren können, lässt aber die großen Hebel für systemische Veränderung unangetastet. Für die Organisation ist das (wie gesagt) zunächst funktional – Wasch‘ mich aber mach‘ mich nicht nass! – aus meiner Sicht aber ziemliche Ressourcenverschwendung.
Attraktive Produktvision statt dröger Definition
Wer über soziale Innovation spricht, kommt nicht umhin zu sagen, was er oder sie damit meint. Nicht selten wird dann der alte Schumpeter rausgeholt und sein Dreischritt mit irgendwelchen Worten aus der Managementtheorie garniert. Da heißt es dann vielleicht, soziale Innovation sei die (Ko-)Kreation, Implementierung und Verbreitung von im jeweiligen Kontext neuer Produkte, Prozesse und/oder Strukturen, zum Behuf der Bearbeitung sozialer Probleme. Oder, wie es in der SI-Literatur beispielhaft formuliert wird:
[Social Innovation refers to] the creation and implementation of new solutions to social problems, with the benefits of these solutions shared beyond the confines of the innovators. (Tracey/Stott 2017: 51)
Dinge möglichst klar und eindeutig definieren zu können, ist natürlich nicht verkehrt. Man sollte schon wissen, worum es geht. Wissen heißt aber nicht, dass man ständig versuchen muss, den Pudding an die Wand zu nageln. Zumal er dadurch auch nicht besser schmeckt! Wusste schon Rilke:
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. / Die Dinge singen hör‘ ich so gern. / Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. / Ihr bringt mir all die Dinge um.
(Rainer Maria Rilke)
Anstatt also lebendige Phantasie, Kreativität und Innovation mit drögen Definitionen abzutöten, macht es meines Erachtens mehr Sinn, die Sache offener zu formulieren. Nicht um Beliebigkeit vorzuschwindeln, sondern eine blurry vision davon zu vermitteln, was bei all dem rauskommen soll, woran es sich also lohnt gemeinsam zu arbeiten. Das können zum Beispiel Aussagen wie die diese sein:
Innovation ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird. Dass es einen Fortschritt gibt, eine Perspektive.
(Wolf Lotter 2018: 19)
Skalierung und Impact statt immer neuer Experimente
Neben den sechs „Innovationspathologien“, über die ich an anderer Stelle hier im Blog schon ausführlich geschrieben habe, ist für mich eine der zentralen Erkenntnisse aus der Studie „Innovation and Scaling for Impact“ von Christian Seelos und Johanna Mair (2017) die zum „organizational immune system“. Insbesondere in etablierten Nonprofits mit lang geübter Arbeitsteilung gilt in einem Satz:
Most ideas are bad ideas!
Das soll nicht heißen, dass man nicht Neues ausprobieren, ungewohnte Pfade nicht beschreiten oder gute Ideen nicht auch gegen Widerstände verfolgen sollte. Es heißt schlicht, dass die wenigsten Ideen sofort fliegen lernen. Die meisten werden aus (mehr oder weniger) guten Gründen aussortiert und landen – im besten Falle – in der Peripherie der Organisation, in der Ecke mit den Leuchtturmprojekten. Manchmal ist die Zeit natürlich einfach noch nicht reif und man kann das Konzept Jahre später wieder aus der Schublade holen – es heißt ja nicht umsonst: Jede Idee hat ihre Zeit. Die Strategie aber, einfach immer neue Experimente zu starten und dabei zu hoffen, dass das eine oder andere PS schon irgendwie irgendwann auf die Straße kommt, ist meiner Meinung nach ziemlich ineffektiv und kostspielig.
Wenn es darum geht, berechtigten Anlass für die Hoffnung auf Besserungzu stiften, halte ich es für viel sinnvoller (a) in dem Kontext zu agieren, in dem man noch am ehesten verstehen kann, was eigentlich das Problem ist, (dazu gleich mehr) und (b) von Anfang an dafür Sorge zu tragen, dass die PS tatsächlich auch auf die Straße kommen, dass sich die gemeinsame Investition also lohnt. Das ist beileibe nicht einfach! Man kann sich anstrengen, wie man will, die meisten Ideen bleiben schlechte Ideen. Echten Impact – oder besser: erwartbare Outcomes – zu bewirken, braucht viel Zeit; den Mut, die eigenen Ideen immer wieder über den Haufen zu werfen; die Geduld anderen, auch unbequemen Zeitgenossen, genau zuzuhören; und das Vertrauen, das eigene Baby auch aus der Hand geben zu können.
Veränderung von innen statt Beratung von außen
Wenn es um die Implementierung von neuen Lösungen geht, die den direkten Wirkungskreis der Innovator!nnen verlassen sollen, ist ein genaues Problem- und Potentialverständnis im jeweiligen Kontext von zentraler Bedeutung. Es ist einfach naiv anzunehmen, aus klugen Metabeobachtungen Schlüsse darauf ziehen zu können, was eigentlich das Problem ist und welche Potentiale tatsächlich vorhanden sind, um es effektiv angehen zu können.
Fuck-Up-Case „Teamblog“ Mit dem hehren Ziel, den Wissenstransfer in meinem damaligen Team zu verbessern, der Potential-Annahme spannende Erkenntnisse würden in maschinenleserlicher Textform (zumindest im kleinen Kreis) per E-Mail geteilt und der naiven Vorstellung, mit digitaler Technik könnte dieses Potential multipliziert werden, versuchte ich um das Jahr 2017 einen Teamblog einzuführen, in dem kurze Veranstaltungsberichte abgelegt werden sollten. Das Vorhaben scheiterte auf ganzer Linie: Erstens, weil die Potential-Annahme schlicht nicht zutraf (die Kolleg!nnen sprachen lieber miteinander als sich E-Mails zu schicken); zweitens, weil sich die Widerstände gegen die Blog-by-Mail-Technik mit ihrer ungewohnten Syntax als unüberwindlich herausstellten; und drittens, weil der Mehrwert nur über den Umweg einer passwortgeschützten Internetseite mit kryptischer URL erlebbar war – und zwar auch nur dann, wenn in Betracht gezogen wurde, das Informationen aus Nachbarsilos für die eigene Arbeit tatsächlich von konkreter Relevanz sein könnten.
Man mag nun einwerfen, dass Methoden wie die des Design-Thinking genau darauf abzielen, diese Probleme und Potentiale zu identifizieren. Und das stimmt sicher auch! Zumindest so lange, wie man sich nicht einbildet, ohne tiefere Systemkenntnis, allein auf der Grundlage von Interviews, Beobachtungen, Workshops und dergleichen, einen „Point of View“formulieren zu können, von dem aus alles offensichtlich wird. Übersehen wird dabei nämlich all zu leicht, dass jede Intervention (auch ein harmloses Gespräch beim Kaffee) unabsehbare Nebeneffekte zeitigt und das Problem- / Potentialverständnis deshalb permanent aktualisiert werden muss.
Methodensets wie Design Thinking bieten im Sinne gegenseitigen Verständnisses nützliche Anlässe zum Dialog und kreative Techniken der Dokumentation. Man kann damit zum Beispiel, um es mit Jeff Patton (2015) zu sagen, so etwas wie Urlaubsfotos aus der Zukunft entwickeln, die das gemeinsame Ziel immer wieder vor Augen führen und Anlass für hoffnungsfrohe Dialoge über das Wie des gemeinsamen Weges bieten. Um das Moving Target eines aktuellen Problem- / Potentialverständnisses allerdings wirklich ins Auge fassen zu können, reicht das bei Weitem nicht aus. Es braucht hier Natives, die tagtäglich Zugang zu den relevanten Informationen haben, ständig (nicht nur gelegentlich) beobachten können und für Themen der Veränderung ansprechbar sind. Es braucht Intrapreneurs.
Taktiken für Intrapreneurs
Intrapreneurs – Menschen, die Debra Meyerson (2008) „Tempered Radicals“ nennt – gibt es auf allen Ebenen in allen Organisationen. Es sind die Menschen, die gelegentlich die Extrameile gehen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie damit ein persönliches Anliegen, einen Purpose, verbinden und davon überzeugt sind, dass die Organisation dafür die richtigen Hebel bietet. Debra Meyerson hat in den 1980er und 90er Jahren solche Menschen studiert und fünf Taktiken identifiziert, die sie regelmäßig einsetzen, um Veränderung zu bewirken:
(1) Stiller Widerstand: Stilbrüche als Angriffe auf die Organisationskultur
Mit der Taktik des stillen Widerstands lassen sich individuelle Freiheiten betonen und alternative Framings in Anschlag bringen. Sneaker zu tragen, wo sonst Lackschuhe gehen, ist ein einfaches Beispiel. Etwas mehr advanced sind meme-artige Kommunikationsmittel, mit denen sich potentielle Allies zu erkennen geben. Im DRK hieß es in einschlägigen Kreisen zum Beispiel: „Um Verzeihung zu bitten, ist einfacher, als um Erlaubnis zu fragen.“
(2) Gelegentliche Konfrontation: Intrapreneurship ist Kampfsport
Mit der Taktik gelegentlicher Konfrontation lassen sich vorhandene Konflikte thematisieren und entsprechende Reflexionsprozesse anstoßen. Kurz mal „Halt“ zu sagen und zu fragen, ob dem Gegenüber eigentlich klar ist, was er oder sie da gerade gesagt hat, ist ein Beispiel. Wieder etwas mehr advanced ist das Verbal Jiu-Jitsu. Hier wird der Schwung eines verbalen Angriffs oder eine Blockade genutzt, um ihn zurückzuwerfen. Als ich vor ein paar Monaten einem Kollegen erklärte, warum etwas so sei, wie es eben sei, erwiderte er wirkungsorientiert: „Hannes, deine Hinleitung kann ich gut nachvollziehen. Das Ergebnis muss aber ein anderes sein.“
(3) Systemisches Verhandeln: die größeren Hebel suchen
Mit der Taktik des systemischen Verhandelns rückt das größere Ganze in den Blick. Bei Verhandlungen an den Interessen des Gegenübers anzusetzen, ist eine Möglichkeit. Weitergedacht kann auch die Wahl des Gegenübers in den in den Blick genommen werden. Als wir seinerzeit den Blog der DRK-Wohlfahrt einführten, richtete mein damaliger Chef seine Überzeugungsarbeit explizit an einen einzelnen Kollegen, der qua Dienstzeit für viele ein Vorbild war. Als dieser Kollege dann anfing Blogartikel zu veröffentlichen, gab es keine Ausrede mehr.
(4) Skalieren kleiner Erfolge: Chancen nutzen, wenn sie sich bieten
Mit der Taktik der Skalierung kleiner Erfolge lassen sich zunächst unauffällige Veränderungen nutzen, um ein Umdenken, in größeren Maßstäben zu bewirken. Der Nudge, die Standardeinstellung am Drucker auf Duplex zu stellen, hilft zum Beispiel das Thema Papierverschwendung ins Blickfeld zu rücken. Etwas konkreter ließ sich die (rückblickend vielleicht etwas unbedachte) Aussage des damaligen Marketing-Chefs im DRK – „Mit 140 Zeichen könnt ihr doch nichts kaputt machen“ – zu einer ausgewachsenen Social Media Policy skalieren.
(5) Organisation gemeinsamer Aktionen: Collective Impact
Mit der Taktik der Organisation gemeinsamer Aktionen wird die genese praktischer Beispiele ermöglicht, die zeigen, dass es (auch anders) geht. Ein guter Ansatz hierfür sind WOL-Circle, die über die üblichen Grenzen von Organisationen und Hierarchien hinweg Peer-to-Peer Unterstützung für Intrapreneur!nnen bieten können. Ein anderer Ansatz sind BarCamps, die als Plattformen für gemeinsame Projekte fungieren. Ein schönes Beispiel hierzu ist die, auf dem Cross Media Day entstandene, Idee einen Digitalen Ortsverein zu gründen (Podcast dazu), der provokanter Weise mit der URL www.DRK-Digital.de versehen wurde.
Wrap-Up: Versuch einer Zusammenfassung
Ich muss gestehen, dieser Text ist etwas länger geworden, als ich es mir vorgenommen hatte. Meine Hoffnung ist trotzdem, dass er euch, die ihr bis hier hinten durchgehalten habt, an der einen oder anderen Stelle einen Mehrwert bot. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich wenig Aktuelles zu Innovation in etablierten Nonprofits – sei es der DOSB oder das DRK – zu sagen habe. Ich kann ja aus mehreren Gründen nicht mehr behaupten, in einer schon langjährig-etablierten NPO zu arbeiten.
Meiner Überzeugung aber, dass sich systemische Veränderung – soll sie denn Hoffnung machen, dass es besser wird – nicht von außen anschieben lässt, tut das keinen Abbruch. Lasst gern ein Kommentar da, wenn ihr gute Beispiele ergänzen wollt. Und auch sonst: Fühlt euch frei diese wunderbare (von mir moderierte) Funktion zu nutzen.
Quellen: Meyerson, Debra E. (2008): Rocking the Boat. How to effect change without making trouble. Boston. (Blick ins Buch) Lotter, Wolf (2018): Innovation. Streitschrift für barrierefreies Denken. Hamburg. Patton, Jeff (2015): User Story Mapping. Die Technik für besseres Nutzerverständnis in der agilen Produktentwicklung. Heidelberg. Seelos, Christian / Mair, Johanna (2017): Innovation and Scaling for Impact. How Effective Social Entreprises do it. Stanford. (Blick ins Buch) Tracy, Paul / Stott, Neil (2017): Social Innovation: A window on alternative ways of organizing and innovating. In: Innovation. Organization and Management (19/1), S. 51-60. Zimmer, Annette / Priller, Eckhard (2022): Zur Lage des Nonprofit-Sektors in Deutschland. In: Klein, Ansgar / Sprengel, Rainer / Neuling, Johanna (Hrsg.): Engagementstrategien und Engagementpolitik. Jahrbuch Engagementpolitik 2023. Frankfurt am Main, S: 93-100.