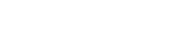Von Zeit zu Zeit witzle ich über mich selber als „passionierten Antragsprüfer“. Auch wenn die Antragsprüfung bei der DSEE mittlerweile ganz in den Händen versierterer Ehrenmänner und -frauen liegt, finde ich es immer wieder spannend, über die Vorhaben einzelner Non-Profits zu lesen. Die Drähte zur engagierten Zivilgesellschaft lassen sich so ganz gut spannen. Besonders freue ich mich, wenn mir dabei neue, mutige Ansätze begegnen. Soziale Innovationen finde ich halt sexy!
Unsexy dagegen finde ich mithin die Art und Weise ihrer Darstellung. Ich persönlich bin ein Textmensch. Bunte Pitch-Decks sind für mich kaum mehr als schmückendes Beiwerk. Deshalb dachte ich mir, lasse ich hier mal ein paar Tipps für gute Texte fallen: Texte über Projektvorhaben, die von eigentlich Interessierten wie mir eigentlich gern gelesen und vor allem gern weitergelesen werden. Die üblichen Formalia der Antragstellung, wie auch den weiteren Weg eingereichter Anträge bei der Ehrenstiftung lasse ich hier aus.
Basics der Antragstellung
Fangen wir mit den Basics an: Um was geht es eigentlich? Anträge oder Projektskizzen zielen auf eine Partnerschaft. Das heißt es geht darum gemeinsam etwas zu bewirken. Vor dem Antrag-Schreiben macht es also Sinn herauszufinden, was der Adressat aktuell eigentlich will. Dafür ist es wichtig die jeweiligen Leitbilder, Statuten, Richtlinien, Förderleitfäden, Arbeitsprogramme und dergleichen genau zu kennen.
Man kann das natürlich auch bleiben lassen und aufs Geratewohl einen Projektpitch losschicken. Vielleicht stehen die Sterne ja zufällig gut. Vielleicht wird dem Gegenüber damit auch ein Aspekt engagierter Praxis deutlich, den er oder sie bislang noch gar nicht bedacht hatte. Das ist gut und richtig – mit der gezielten Anbahnung einer Partnerschaft aber hat das nicht viel zu tun.
Wie wird also dieser Abgleich von Zielen und Interessen zwischen Antragsteller und Adressat organisiert? Ganz einfach: mit einem Antragsformular. Oder einfacher: mit einer Sammlung relevanter Fragestellungen. Und weil meistens der Fördermittelgeber in der Not ist, irgendeinen Prozess für die Antragstellung organisieren zu müssen, formuliert er auch die Fragen.
Es macht durchaus Sinn, diese vorgegebenen Fragestellungen ernst zu nehmen. Zwar wird die Bürokratie – und Antragsformulare gehören sicher in diese Kategorie – oft als Ärgernis wahrgenommen, doch hat sie hier durchaus ihre Berechtigung. Sie bringt etwas Struktur in die Angelegenheit und ermöglicht einen fairen Auswahlprozess.
Man kann diese Struktur natürlich auch ‚aufbrechen‘, kreativ damit umgehen oder random irgendwas anderes mit den Formularen anstellen. Aktionskunst ist immer cool! Der Anbahnung einer Partnerschaft scheint mir das aber nicht sonderlich zuträglich. Besser ist es tief durchzuatmen und die Fragen einfach zu beantworten.
Antragstexte schreiben
Auch hier kurz und knapp ein paar Basics, mit denen man beim Antrag-Schreiben schon ziemlich weit kommt: Verwende aktive Sprache, fasse dich kurz und schreibe allgemeinverständlich. An wissenschaftlichen Ausführungen in langen Schachtelsätzen, garniert mit Fachbegriffen, die keine 1.000 Treffer bei Google erreichen, hat niemand Freude (außer manche Wissenschaftler:innen natürlich). Im Folgenden steige ich von hier aus etwas tiefer ein. Den Start mache ich mit der kleinsten Sinneinheit eines Textes: den Worten.
1. Die Wortwahl: Wähle weise!
Grundsätzlich gilt: Ein Wort ist umso verständlicher, umso angenehmer, umso kraftvoller, je weniger Silben es hat.
Wir sind ständig von Einsilbern umgeben: Haus und Hof, Berg und Tal, Stadt und Land… Warum sollten wir also zum Beispiel vom „Paradigmenwechsel“ schreiben? Das Wort hat sechs Silben – vier davon griechisch. Warum nicht „Kurswechsel“ (drei Silben) oder „Wandel“ (zwei Silben) oder „Schwenk“ (eine Silbe)? Je weniger Silben, desto verständlicher, desto kraftvoller: „Yes We Can!“
Auch sind wir permanent von konkreten Dingen umgeben, die wir riechen, schmecken, hören und tasten können. Es lohnt, diese auch konkret zu benennen. Was hilft es von „Emissionen“ zu schreiben, wenn „Abgase“ gemeint ist? Es ist doch viel eindrücklicher, wenn wir das Gemeinte fast riechen können.
Bei der Wahl der Worte lohnt es sich also Silben zu sparen und Anker in den Alltag zu werfen. Wenn dafür im Übrigen Anglizismen nötig sind, bitteschön: Was wäre denn auch einzuwenden gegen „Sex“, „Team“ oder „Test“? Gar nichts. Gegen den „Approach“ indes habe ich was. Das ist unnötiger Entrepreneurship-Schwulst für „Ansatz“.
2. Der Satzbau: Kurz und gut!
Der Ideale Satz macht in wenigen, wohl bekannten Worten eine klare Aussage.
Am eingängigsten sind knackige Hauptsätze, die eine Frage beantworten: „Wer tut was?“
Zum Beispiel: „Die Ehrenamtlichen vor Ort verteilen Flyer.“ Warum sollte man das noch mit irgendwelchen Nebensätzen garnieren? Vielleicht weil sonst eine wichtige Erläuterung verloren geht: „Die Ehrenamtlichen vor Ort verteilen Flyer, um über unsere Kampagne zu informieren.“ Okay. Mehr aber nicht! Vor allem nicht: „Die Ehrenamtlichen vor Ort informieren über unsere Kampagne, indem sie Flyer verteilen.“ Und schon gar nicht: „Zur Information über unsere Kampagne verteilen Ehrenamtliche, die sich vor Ort engagieren, Flyer.“
Manchmal ist aber auch ganz ohne Nebensätze Vorsicht geboten. Besonders dann, wenn wir es mit getrennten Verben zu tun haben (bspw. im Perfekt – „habe gemacht“, „ist gewesen“ usw.). Man bedenke: Die Zeit, die ein Mensch als Gegenwart erlebt, beträgt nicht mehr als drei Sekunden. Und wie viele Worte lesen wir in drei Sekunden? Im Durchschnitt nicht mehr als sechs. Nicht mehr als sechs Worte also dürfen das Verb trennen: „Die Ehrenamtlichen vor Ort konnten bei starkem Regen keine Flyer verteilen.“ Okay – fünf Worte zwischen „konnten“ und „verteilen“. Aber: „Die Ehrenamtlichen vor Ort konnten wegen des nicht angekündigten Gewittersturms keine Flyer verteilen.“ Merkt ihr selber, oder?
3. Die Struktur: Mitten rein!
Wenn dein erster Satz für einen Schulaufsatz taugt, dann schmeiße ihn weg.
Einleitung – Hauptteil – Schluss. Das ist was für den Deutschunterricht. Bei guten Texten heißt das Zauberwort „Storytelling“. Auch Stories haben Struktur. Die Spannungsbögen ziehen sich dabei aber über den ganzen Text und müssen nicht vorgreifend (Einleitung) und rückblickend (Schluss) zusammengefasst werden. Was hängen bleiben soll, ist in die Textstruktur eingeschrieben: Wer ist der Held der Geschichte, wer der Mentor, wer der Bösewicht? Was ist das Problem, was ist die Lösung?
Ein Antrag ist keine Hausarbeit! Er ist natürlich auch keine frei erfundene Geschichte. (Dazu weiter unten mehr.) Ein guter Text zieht die Lesenden in den Bann und lässt sie nicht mehr los. Eine besondere Herausforderung dabei ist der Einstieg. Wie findet man den? Zunächst: Konstruktionen à la „Kennen Sie das auch?“ oder „Was hat X und Y gemeinsam?“ taugen nicht viel. Der Einstieg sollte überraschen und neugierig machen. Bei platter Werbung schalten Leser:innen schnell ab. Besser:
Raúl wurde mit Glasknochen geboren – aber Dachdecker wollte er eh nicht werden.
Hier wird ein vermeintlich ‚persönliches Schicksal‘ wunderbar eingängig beschrieben („Raúl wurde mit Glasknochen geboren“), um dann über die Assoziationen von Hilflosigkeit und fremdbestimmtem Leben zu spotten („Dachdecker wollte er eh nicht werden“). Ein toller Aufhänger, um auf echte Inklusion neugierig zu machen.
4. Der Gesamteindruck: Kill your Darlings!
Wenn du einen starken Text produzieren willst, schmeiß die Adjektive weg – zumindest die meisten.
Klar, Adjektive – „Wie-“ oder „Eigenschaftswörter“ – geben Texten Farbe: das blaue Kleid, nicht das grüne; die grauen Wände, nicht die bunten… Ein paar davon braucht jeder Text. Oft wird es mit der Farbe aber übertrieben, zum Beispiel mit „engagierten Ehrenamtlichen“ oder „gezielten Maßnahmen“. Das ist tautologisch – doppelt gemoppelt – also unsinniger Schwulst.
Nicht nur unsinnig sondern irreführend wird es, wird behauptet, bestimmte Eigenschaften wären vorhanden obwohl sie das vielleicht gar nicht sind: Gern wird etwa von „nachweislich wirksamen Projekten“ oder „wissenschaftlich erwiesenen Effekten“ geschrieben obwohl sich im Text nichts dergleichen findet. Ich zumindest werde hier ziemlich schnell ziemlich skeptisch und schaue umso genauer hin.
Skeptisch sollten alle werden, die bemerken, dass sie beim Schreiben nach ‚Schema F‘ verfahren – die zum Beispiel zwanghaft Synonyme suchen, um ja kein Wort zu wiederholen. Am Ende nämlich, wenn alles im Synonym-Brei verschwimmt, wiederholt sich nur noch der Name der Organisation. Es entsteht ein fader Beigeschmack.
Antragstexte reviewen
Es kann etwas sehr Schönes sein, mit (s)einem Text in eine Antwortbeziehung zu treten – zu versuchen, ihm die eigenen Gedanken einzuschreiben und dabei zu bemerken, wie er seinerseits das Denken verändert. Gleichgültig aber ob das Antragschreiben wirklich schön oder nur anstrengend ist: Man verbringt doch einige Zeit mit dem Text. Im Ergebnis wird man blind für die Fehler, die wir alle machen. Von den üblichen Typos (Rechtschreibung & Grammatik) bis zu Copy- & Paste-Fehlern wie doppelte Textpassagen oder fehlende Referenzen ist dann schnell alles dabei.
Nobody is perfect! Fehler sind ganz normal. Deshalb ist es wichtig, Texte von jemand anderem reviewen zu lassen – wenn’s geht zweimal: einmal mit der fachlichen Brille und einmal mit der Duden-Brille. Wer fachlich liest konzentriert sich auf den Sinn, auf die Referenzen, auf die Strukturen und sieht aus dieser Flughöhe die kleinen Typos nicht. Mit der Duden-Brille dagegen geraten die größeren Zusammenhänge leichter aus dem Blick.
Ein zusätzliches Review kann man außerdem den Computer machen lassen. Einerseits natürlich mit den automatischen Rechtschreibhilfen der meisten Textprogramme, andererseits mit Textanalyse-Programmen – etwa mit dem Webtool von Wortliga oder WordPress-Plugins wie Yoast SEO. Hier wie dort gilt allerdings das Gebot des Selberdenkens. Automatische Rechtschreibhilfen hauen oft genug daneben und wenn man allen Tipps der Textanalyse-Tools folgt, könnten wir das Schreiben auch gleich ChatGPT überlassen – künstliche Intelligenz kann viel, die Arbeit am eigenen Stil aber kann sie uns nicht abnehmen.
Epilog: Sprache und Soziale Arbeit
Ich habe von 2005 bis 2009 Soziale Arbeit studiert – im Schwerpunkt Bildung, Kultur und Medien. Damals haben wir viel darüber diskutiert, ob und wie sich die Soziale Arbeit ‚verkaufen‘ sollte. Nach meiner Überzeugung war (und ist) das Problem die Zurückhaltung der Sozialen Arbeit gegenüber anderen Professionen. Besonders vom Glanz – oder besser: vom „Uni-Bluff“ (Wolf Wagner) – so genannter Bezugswissenschaften (z.B. Medizin, Verwaltung und Juristerei) lassen sich Sozialarbeiter:innen zu oft beeindrucken.
Zwei Wege aus dieser Zwickmühle erschienen vielversprechend:
- Zum einen die Entwicklung eines fachspezifischen Vokabulars zu dem etwa Worte wie “Voluntarisierung” gehören. Diesen Weg haben die Gender Studies eingeschlagen – mit dem Ergebnis, das Fachtexte, wenngleich auch voller messerscharfer Analysen und kreativer Ideen, für Normalsterbliche kaum noch zu verstehen sind.
- Zum anderen die Orientierung am Marketing- und Werbesprech, wie etwa beim „Gute-Kita-Gesetz“. Hier allerdings werden die Leistungen der Sozialen Arbeit auf die gleiche Stufe wie Zahncreme und Shampoo gestellt – oft genug mit dem Ergebnis, dass das Selbstbewusstsein der Profession nicht gerade gesteigert wird.
Es dürfte nicht wirklich überraschen, dass ich damals für die Orientierung am Marketing- und Werbesprech plädierte. Und ich finde auch heute noch, dass mit dem fachspezifischen Vokabular kaum ein Blumentopf zu gewinnen ist – weder für die Profession der Sozialen Arbeit noch für ihre Darstellung in der (eigentlich interessierten) Öffentlichkeit. Mit Influecer-Marketing & Co haben sich die Zeiten seit meinem Studium geändert: Reklame funktioniert heute anders als noch zu Zeiten des linearen Fernsehens.
Quellen: @reporterfabrik (o.J.): So schreibst du besser. Faustregeln von Wolf Schneider (Wiedergabeliste auf TikTok) Wagner, Wolf (2007): Uni-Angst und Uni-Bluff heute. Wie studieren und sich nicht verlieren? Berlin.